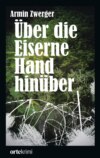Loe raamatut: «Über die Eiserne Hand hinüber»
Armin Zwerger
Über die Eiserne Hand hinüber
Armin Zwerger
Über die Eiserne Hand hinüber
Kriminalroman
orte Verlag
© 2015 orte Verlag, CH-9103 Schwellbrunn
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Janine Durot
Satz: orte Verlag, Schwellbrunn
Gesetzt in Times New Roman
ISBN: 978-3-85830-186-4
ISBN eBook: 978-3-85830-191-8
eBook-Herstellung und Auslieferung:
HEROLD Auslieferung Service GmbH
Für Irmi
Andrea: «Unglücklich das Land, das keine Helden hat».
Galilei: «Unglücklich das Land, das Helden nötig hat».
Bertolt Brecht: Leben des Galilei
Vielleicht weil es keine Geschichte darüber gibt, denkt man nach, wie es hätte sein können oder sogar, wie es wirklich war.
An der Eisernen Hand, mit der heute kaum mehr einer aus Basel etwas anzufangen weiss.
Ganz zu schweigen von denen aus Stetten oder Lörrach oder Weil oder auch Grenzach.
Dabei sollte es gerade die interessieren, sollte man meinen.
Aber wahrscheinlich hätten die Basler wieder mehr Zeit.
Für solche Reflexionen.
Wenn sie sich die Zeit nähmen.
Den Grenzsteinen entlangzugehen und sich zurückzuversetzen in eine Zeit, in der nicht einmal so ein Stein ohne Schuld war.
Wie denn ein Mensch ohne Schuld hätte sein können.
Es gibt Geschichten, aber nicht wirklich eine Geschichte.
Die Gegend meiden? Warum? Wegen der Erinnerung?
Es gibt eine Gedenkstätte. Gut zu erreichen mit der Tram.
Linie 6.
Von der Innenstadt her.
Dann kann man auf Busse umsteigen.
Zu einem Gedächtnisort.
Und die Grenzsteine, die gibt es noch.
Dort wo Vergangenheit und Gegenwart ineinander übergehen.
Erinnert man sich vielleicht an etwas, was man weder erlebt noch gesehen hat.
Aber hätte ja sein können.

Jetzt sind es schon zehn Minuten. Das kann doch nicht so schwer sein, diesen 1700-er zu finden! Und dann soll sie nach rechts. Die findet den Stein nicht, die blöde Kuh!
Das Wasser im Mundwinkel fing an zu gefrieren. Einmal mit der Zunge drüber, dann war es wieder aufgetaut. Mehr Bewegung war im Augenblick nicht möglich. Die Kälte wurde immer unerträglicher. Aber seit die beiden Grenzsoldaten dort oben auf dem Ansitz neben dem Zaun hockten, verbot sich jede weitere Bewegung. Noch hatten sie ihn nicht gesehen, und das sollte auch so bleiben. Denn wenn sie ihn noch einmal an der Grenze erwischen würden … Der Ortsgruppenführer hatte sich da ganz klar ausgedrückt. Das hatte auch er mit seinen knapp dreizehn Jahren kapiert.
Was sie mit der Frau machen würden, wenn die plötzlich aus dem Wald auftaucht? Er hatte keine Ahnung. Jedenfalls hatten sie dann jemanden, um den sie sich kümmern konnten. Und er bekam eine Chance abzuhauen.
Aber jetzt schlotterte er in diesem Gebüsch. Wagte es nicht, sich zu rühren. Fluchte auf seinen Alten, der ihn in diese Situation gebracht hatte. «Lass dich ja nicht erwischen,» war seine gängige Redensart. Er wollte sich nicht erwischen lassen, nie wollte er sich erwischen lassen. Dennoch erwischten sie ihn immer wieder. Und jetzt blutete auch noch die Hand. Er hatte sich schon wieder an diesem ekelhaften Stacheldraht verletzt. Oder war es doch das Dornengestrüpp?
«Kein Problem.» Wenn man den Alten hörte, gab es nie ein Problem. «Du zeigst ihr den Weg durch den Zaun. Und dann wartest du genau eine Stunde. Keine Minute länger! Hier die Uhr. He, das ist eine teure Uhr aus der Schweiz. Wenn du sie verlierst, zieh ich dir die Hammelbeine lang.»
Jetzt hielt er die Uhr in der Hand, die immer noch blutete.
«Wenn sie nach einer Stunde nicht kommt, gehst du. Runter ins Dorf und von dort nach Hause. Wenn sie kommt, lass sie voraus laufen. Sie soll in den ‹Kranz›. Sie weiss schon. Dann geh ihr nach bis dort hin, und schau, dass du nach Hause kommst. Je weniger ihr gesehen werdet desto besser.»
Für den Alten war das eine lange Rede. Aber die Anweisungen waren klar.
Was er nicht gesagt hatte war, dass die Frau wohl nur eine vage Vorstellung vom Weg hinter dem Zaun hatte. Deshalb hatte sie ihn auch immer wieder nach dem alten Grenzstein gefragt. Er fand, dass der auch nicht viel anders aussah als die anderen. Das behauptete nur der Dorflehrer. Bei dem hatte jeder dieser Steine eine Seele, über die er sich stundenlang auslassen konnte. Es war halt ein Grenzstein! Was hätte er sonst sagen sollen?
Vielleicht war diese Frau noch nie in der Schweiz gewesen. Gesehen hatte er sie vorher genauso wenig wie andere auch, die der Alte anschleppte, damit er sie durch das Loch im Zaun schleuste. Wahrscheinlich dachte sie auch, dass da auf dem Land am Ende der Welt die Zeit ohnehin keine Rolle spielt. «Eine Stunde, zwei … war doch egal. Soll der Kleine doch ein bisschen frieren.» Aber seit die Hakenkreuzler auch im Rathaus sassen, spielte die Zeit eine Rolle. Und eine Weile war das schon her.
Immer wieder schaute er auf die Schweizer Uhr. Die Zeit war längst abgelaufen. Die Frau hätte längst zurück sein müssen. Schweizer Uhren gehen perfekt. Und er musste in diesem Gestrüpp sitzen bleiben. Auf keinen Fall sollten ihn die beiden Grenzsoldaten zu Gesicht bekommen. Also musste er warten. Irgendwann würden die beiden wieder verschwinden.
Aber die Uhr war die Sache wert, dachte er. Wie kommt der Alte nur immer wieder an solche Sachen? Nichts Ordentliches zu essen daheim, aber eine Schweizer Uhr. Typisch für den Alten.
Verkaufen konnte er sie nicht, auch nicht für ganz wenig Geld. Er hätte sie auch nicht für irgendetwas einhandeln können, etwas worüber die Mutter sich freuen würde. Weil das herauskommen würde, und dann ginge das Theater wieder los. Schlitten fahren würden sie mit ihm. Er hatte schon genug auf dem Kerbholz. Das jedenfalls behauptete er immer, wenn er seinen Jungen wieder für eine Sache einspannte.
Deshalb war er es auch, der hier schlotterte und nicht der Alte. Der sass jetzt wahrscheinlich in der warmen Wirtsstube hinter einem Glas Wein oder zwei. Ich bin es, der sich hier den Arsch abfriert, dachte er. Dass die Uhr schön war, fand er auch, schwer mit einer Menge Gold überall. Wie gleichmässig sie läuft und tickt, dachte er auch noch, und als er aufschaute, standen die beiden vor ihm.
*
Es waren zwei Soldaten. Nicht die Grenzsoldaten. Die standen immer noch oben. Er konnte sie aus den Augenwinkeln sehen, obwohl sie offensichtlich versuchten, möglichst unbemerkt zu bleiben und fast ganz hinter einer Tanne verschwunden waren. Das waren auch keine Zöllner, von denen er einige kannte und die anders gekleidet waren.
Uniformen hatten die beiden an, aber die waren unter den weiten Mänteln kaum zu erkennen. Sie wirkten irgendwie gehetzt, hatten es offensichtlich sehr eilig. Sie schienen nicht weniger erschrocken zu sein, als sie so plötzlich vor ihm standen. Erst im letzten Augenblick hatten sie ihn in den Büschen entdeckt.
«Was machst du da?» Die Frage war scharf gestellt und gleichzeitig unsicher.
«Nüüt», sagte er und dehnte das Wort, so dass man ihn für einen Jungen aus der Schweiz hätte halten können, der sich an der Grenze herumtrieb. Denen war das natürlich auch verboten, aber auch für einige Kinder von der anderen Seite des Zauns aus Riehen und aus Bettingen bestand gerade darin der Reiz der Grenze.
Diese beiden Soldaten waren offensichtlich Fremde. Er hatte sie noch nie gesehen, und zumindest in diesem Grenzabschnitt kannte er jedes Gesicht. Ausserdem hatten die wenigen Worte, die sie gesagt hatten, verraten, dass sie aus einer ganz anderen Gegend kamen. Was sollten die sich um Schweizer Kinder kümmern? Grenze hin und Zaun her.
Er schien Glück zu haben. Sie hielten sich nicht lange mit ihm auf, schoben sich an ihm vorbei und verschwanden jenseits des Stacheldrahtverhaus im Wald.
Die Grenzsoldaten auf dem Ansitz mussten das gesehen haben, das wurde ihm schnell klar. Dass diese Männer vor ihm stehen geblieben waren, mit ihm gesprochen hatten und dann durch den Zaun gegangen waren. Da konnte er jetzt aus seinem Versteck genau so gut heraus. Jetzt war es keines mehr.
Warum rührten die da oben sich nicht, wieso hatten sie die beiden einfach durchgelassen? Das ging ihm durch den Kopf, als sein Blick auf seine Hand fiel, in der gerade noch das beruhigende Ticken der Uhr zu hören gewesen war.
Sie blutete nicht mehr … und die Uhr war weg. Sie lag auch nirgendwo. Einer der beiden musste sie ihm im Vorbeigehen aus der Hand genommen haben. Und er hatte so Schiss gehabt, dass er nichts davon gemerkt hatte.
Jetzt war sowieso alles egal. Sollten die Scheisskerle doch schiessen. Er kroch aus seinem Versteck, schüttelte sich Schneereste vom ganzen Körper ab und ging langsam und gleichgültig über die Grenze durch das Loch im Zaun zurück Richtung Dorfstrasse. Als dann wirklich geschossen wurde, erschrak er doch und rannte los.
Die Schüsse galten nicht ihm, er hörte Holz splittern, dumpfe Schläge gegen einen Baum. Das mussten die beiden auf dem Ansitz gewesen sein, die da in den Wald hineingezielt hatten. Getroffen dürften sie allerdings kaum haben, dazu hatten sie viel zu lange gewartet, und danach war es wieder still wie zuvor. Als er schon fast unten am Bach war, hörte er noch einmal Schüsse. Weiter weg diesmal. Er zählte die Schüsse mit.
Geschossen wurde hier immer einmal wieder, auch früher, als die Grenze noch nicht mit Stacheldrahtzaun verbarrikadiert war. In der Schweiz hatten sie dort einen Schiessstand, nicht weit von der Grenze entfernt, auf der anderen Seite des Tals, und je nach Windrichtung konnte man hier schon mitbekommen, wann eidgenössische Übungen angesagt waren.
Diese Schüsse aber kamen unweit vom Gipfel des Berges nicht aus dem Tal dahinter.
Unweigerlich duckte er sich und rannte dann, so schnell Beine, Stock und Stein es zuliessen, hinunter zum Bach.
Von da bog er in Richtung des oberen Dorfes ab. Das hatte der Alte zwar nicht gesagt, aber er verspürte kein Bedürfnis jetzt schon den Heimweg anzutreten.
Er lief ein ganzes Stück den Bach entlang und versteckte sich dann hinter der Muggenthaler-Scheune und blinzelte von dort in Richtung Eingang des alten Wirtshauses. Von hier konnte er jeden sehen, der in den «Kranz» hineinging oder herauskam. Er wartete auf seinen Alten.
*
Die beiden Grenzsoldaten auf dem Ansitz hatten ihren Auftrag erfüllt. «Beobachten», hatte es geheissen, «und dann ein bisschen hinterherschiessen.» Aktionen von der Gestapo oder dem Sicherheitsdienst waren grundsätzlich gut organisiert, und dank der Hilfe des örtlichen Schleusers war mit Schwierigkeiten eigentlich nicht zu rechnen. Der Zoll wusste nichts von der Aktion; es wirkte immer glaubhafter, wenn nicht zu viel Wind von einer Sache gemacht wurde.
Was die beiden zu sehen bekamen, waren aber nicht nur die zwei erwarteten Agenten, da tauchte plötzlich ein Junge auf, der hier eigentlich nichts zu suchen hatte. Entweder einer dieser Rotzlöffel aus dem Dorf, der sich verbotenerweise viel zu nah an der Grenze herumtrieb. Möglicherweise aber auch einer dieser Schweizer Knaben, der Abenteuer suchte. Dort hatte man die Kinder halt nicht so im Griff.
Dass der Junge sie gesehen hatte, mussten sie in Kauf nehmen. Man würde Meldung machen.
Als die Agenten wie geplant hinter der Grenze verschwunden waren, schoss man pflichtbewusst ein wenig hinterher, worunter einige Buchen etwas zu leiden hatten. Schliesslich konnte man nicht einfach zwei Deserteure, schwere Jungs auch noch, wie man später den Schweizer Grenzern stecken würde, ungestraft abhauen lassen, ohne wenigstens den Versuch gemacht zu haben, sie zur Strecke zu bringen.
Erst als einige Zeit später, die Soldaten waren gerade dabei aufzubrechen, noch einmal Schüsse zu hören waren, wurden die beiden stutzig.
Da wurde auf der Schweizer Seite geschossen. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Man würde Meldung erstatten müssen, nicht nur in Lörrach.
Unten fährt eines der grünen Zollautos vorbei. Seit man in der Schweiz Schengen unterzeichnet hat, stehen die beiden Zollhäuschen an der Grenze leer. Das auf Schweizer Seite eigenartigerweise ohnehin schon seit Jahren. Jetzt auch das auf deutscher Seite.
Ab sofort wird nur noch sporadisch kontrolliert, ein paar Meter hinter der Grenze, dort wo das alte Zollhaus steht. Ein günstiger Platz, unübersichtlich für den Heranfahrenden, geschickt für die Zöllner. Im Bedarfsfall wird flink die kleine Kelle herausgezogen und an die Seite gebeten.
Oder sie stehen am Ausgang des Dorfes irgendwo in der Landschaft. Unberechenbar eben, so wie es sein muss. Fragt man nach, heisst es, dass es um Devisenschmuggel gehe, vielleicht ist es auch Steuerhinterziehung oder doch nur ein paar Stangen Zigaretten.
Kann mir egal sein. Ich wohne in Deutschland, arbeite in der Schweiz, verdiene gut dort und meine durchaus komplizierten Steuerangelegenheiten überlasse ich einem Steuerberater.
Meine Ferien verbringe ich in Frankreich oder sonst wo, wohin die günstigen Flieger des Euro-Airports von Basel aus mich hintragen.
Über ein Vermögen, das für Zoll oder Steuerfahndung interessant wäre, verfüge ich nicht.
Mich beschäftigen wesentlichere Fragen, seit ich in diesem malerischen Dorf wohne: Vor allem die Frage nach den Socken!
Oben, an der zum Grenzzoll gelegenen Seite der Strasse ins Oberdorf, genau am Ende der Strasse, da liegen sie. Vor einem der schmucken Häuschen, die unserem Dorf diesen Charakter einer Puppenstube geben, dort in der Einfahrt.
Die meisten gehen achtlos daran vorbei.
Dabei liegen sie schon seit einiger Zeit da. Seit wir uns hier niedergelassen haben, zieren sie den Eingangsbereich dieses Puppenhäuschens.
Natürlich sind es immer wieder andere. Der Hausbesitzer räumt sie weg, aber ein paar Tage später liegen wieder welche da. Sommer wie Winter, dünne an heissen Tagen, dicke wollene, besonders dicke sogar an kalten Wintertagen.
Der Hausbesitzer ist ein Basler, denke ich, weil das Haus oft einen unbewohnten, aber nie vernachlässigten Eindruck macht und weil auch immer einmal ein Auto mit Baselstädter Nummer davor steht. Irgendwann hat er ein Schild aufgestellt, handgeschrieben auf einem Karton: «Wir brauchen keine Socken!», stand darauf.
Aber das hat nicht geholfen. Jedes Mal, wenn er sie entsorgte, lagen, oft nur wenig später, wieder Socken vor seinem Eingang. Manchmal nur einer, aber meistens tauchten sie doch paarweise auf. Kindergrösse. Und bunte waren auch dabei. Da das Haus nicht dauerhaft bewohnt ist, ich vermute, der Eigentümer nützt es als Ferien- und Wochenendhaus, gelang es offensichtlich nicht, der Herkunft dieser Socken auf die Spur zu kommen.
Irgendwann hat der Basler sie einfach nur noch auf die Strasse befördert. Von wo aus sie dann regelmässig wieder in den Eingangsbereich zurückgelegt wurden.
Wer schmeisst Socken vor den Eingang eines sporadisch genutzten Hauses in unserem Dorf kurz vor der Stadt und doch irgendwie am Ende der Welt? Hart an einer der wenigen noch existierenden Grenzen im Herzen Europas?
Ich tippe auf die Alte aus dem Grütt, die hier regelmässig ihre Runden dreht. Aber das krieg ich schon noch raus. Irgendwie.
Wenn die Tage länger werden, werden die Schmerzen nachlassen. Daran dachte sie, während sie langsam den Berg hinaufging und es im Kopf dröhnte und stach, hämmerte und bohrte, und einmal mehr erinnerte sie sich daran, dass es höchste Zeit wäre, mit der Sache endlich einen Arzt aufzusuchen.
Der Winter geht vorüber, und nicht jedes Jahr wird so kalt werden wie das letzte. Sie erinnerte sich, dass da Rekordtemperaturen erreicht wurden, die Schmerzen höllisch gewesen waren und dass es weit bis ins Frühjahr gedauert hatte, bis es wieder besser geworden war.
Jetzt musste sie sich erst einmal kurz setzen, weil sie das Gefühl hatte, ein wenig die Orientierung verloren zu haben.
«Immer den Grenzsteinen nach», hatte der Junge in seinem genuschelten Alemannisch, das sie kaum verstehen konnte, gesagt. Bis man zu einem Stein mit der Aufschrift «1700» kam. Dort würde ein schmaler Pfad abgehen, dem sie nicht weiterzufolgen brauche, weil der Bote von dort kommen würde.
So war das ausgemacht, weil, so hatte man ihr gesagt, dort rechnete man nicht mit Derartigem. Die Ecke war nicht wirklich geschickt für Konspiratives. Da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben. Kürzere Wege hinein in die Schweiz. Genau deswegen war das der richtige Ort.
Grenzstein 81.
Aber sie selber wollte nicht in die Schweiz. Was sollte sie da? Sie kannte niemanden dort. In ganz Basel nicht und auch sonst nirgendwo. Obwohl, einfach weg und abhauen, hätte auch etwas Verlockendes gehabt. Alles zurücklassen. Möglich dass dann auch die Schmerzen verschwinden würden.
Grenzstein 82.
Geht aber nicht. Nichts geht mehr.
Der Weg ist steil. Davon haben sie nichts gesagt. Der Junge war sowieso unklar in seinen Angaben. Warum nur war der Alte nicht mitgekommen? Der Kerl war zwar ein unausstehlicher Brummbär, aber sicher einer, der hier alle Wege kannte. Warum nur hatte er sie diesem Jungen überlassen?
Grenzstein 83.
Einen Grenzstein nach dem anderen passierte sie, immer den schmalen steilen Weg entlang. Sollte das jetzt bis 1700 so weitergehen? Langsam wurde ihr klar, dass da etwas nicht stimmte. Auf den Steinen stand noch mehr. Verwittert teilweise und kaum mehr zu entziffern.
Sie setzte sich jetzt einfach neben einen Stein und wartete, bis ihr Blick wieder ganz ungetrübt war. Zur Schweizer Seite hin war ein Wappen zu erkennen. Ein anderes auf der gegenüberliegenden Seite. Einmal war das der Basler Stab. Den kannte sie. Mit dem anderen Wappen konnte sie nichts anfangen. Dann war da noch eine Jahreszahl angedeutet, die schwer zu entziffern war. Vielleicht 1840. Oder 1848.
Ihr war schwindlig geworden, und sie musste sich ein wenig am Stein festhalten. Warum musste auch ausgerechnet jetzt dieser Anfall kommen. So lange hatte sie nichts mehr davon gemerkt. Sie versuchte, ganz ruhig zu atmen.
Man hatte ihr gesagt, dass die Sache gut vorbereitet sei, dass sie sich keine Gedanken machen müsse. «Das ist alles im Vorfeld geklärt, Vreneli», hatte es geheissen.
Wenn der Vorsitzende etwas erklärte, war immer alles leicht. Überall hatten sie ihre Leute, und wenn sie kam, musste nur noch ausgeführt werden. Einer wird da sein, er wird dich finden. Ihr tauscht die Papiere aus. Und dann gehst du wieder zurück. Schon welche Papiere das waren, wusste sie nicht, das wusste sie nie.
Neben den Wappen hatten die Steine auch noch fortlaufende Nummern und gelegentlich Jahreszahlen.
Sie war den Nummern gefolgt. So hatte sie den Jungen verstanden. Immer den Berg hinauf. Sie wusste, dass oben ein Kloster war, und war in diese Richtung gelaufen, als hätte sie gespürt, dass sich dort sicheres Terrain befand. Vielleicht sogar Freiheit. Nur war sie kein Flüchtling, die Freiheit lockte sie nicht. Sie hatte nur etwas auszutauschen. Etwas abzugeben, etwas mitzunehmen.
Jetzt, das spürte sie, war sie auf dem falschen Weg. Die Jahreszahlen auf den Grenzsteinen hatten nicht die Logik fortlaufender Nummern. Die Jahreszahlen zeigten nur, dass in historisch relevanten Abständen neue Grenzsteine gesetzt worden waren.
1889, 1905, 1929 und dann wieder 1880 und 1898. Was immer geschehen war, auf den Verlauf dieser Grenze war wohl mit äusserster Akribie geachtet worden, so dass man immer von einem Stein zum nächsten blicken konnte. Offensichtlich sollte man hier die Grenze nie aus den Augen verlieren.
Ein 1700-er aber war nicht dabei. So alt schien auf dieser Seite keiner zu sein.
Was hatte der Junge noch gesagt? Dass sie nach links solle, den Berg hinauf, dann nach rechts. Wo nach rechts? Dann Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wie genau der Stein aussah, wusste er nicht. «Wie alle anderen», sagte er immer wieder. Aber irgendetwas von 50 oder 52 hatte er auch gesagt, und das konnte eigentlich nur eines bedeuten. Wenn damit die Nummer des Steins gemeint war, musste sie zurück. Steine mit kleineren Nummern konnten nur auf dem Berg gegenüber liegen.
Ihr war klar, dass ihr nun die Zeit fehlte. Eine Stunde hatte es geheissen, mehr Sicherheit gab es nicht. Der Junge würde nicht mehr da sein. Das hatte er klar gesagt. Eine Stunde würde er warten, jede Minute würde er auf seine goldene Uhr schauen.
Sie hätte sich besser erkundigen sollen. Das rächte sich jetzt, dass sie das nicht getan hatte.
Immer wieder quälte sie dieses Hämmern im Kopf, das zunahm in dem Masse, wie der kalte Wind das kleine Tal hinaufblies und immer dickere Nebelschwaden aus dem Rheintal mitbrachte, und langsam spürte sie, wie die Gegend um sie herum immer unwirklicher wurde. Das was hier nördlich des Rheins und jenseits von Grossbasel zur Schweiz gehörte bis hinauf zu diesem Zipfel, den man die Eiserne Hand nannte, das alles war ein eigentümliches Terrain.
*
Jean hatte andere Wege finden müssen um sich mit den Genossen aus Weil und Lörrach in Verbindung zu setzen und Kontakte herzustellen, seit sie die Eisenbahnlinie zwischen Weil und St. Louis eingestellt und dann auch noch die Schiffsbrücke von Huningue aus über den Rhein gekappt hatten. Aber Jean wäre nicht Jean gewesen, wenn ihm das nicht gelungen wäre. Was nicht bedeutete, dass es einfach war. Aber einfach war ohnehin schon lange nichts mehr.
Dennoch war es ihm an diesem Vormittag einmal mehr gelungen die Grenze in die Schweiz zu passieren, den Rhein in Basel zu überqueren und recht unbeachtet im Grenzbereich der Eisernen Hand zu verschwinden.
Das alte Fahrrad führte er an der Hand, wenn es durch die engeren Gassen Basels ging oder durch unwegsames Gelände, meistens aber sass er auf seinem Drahtesel und fuhr zügig an allen, die ihm begegneten vorbei.
Nur wenn man etwas genauer hinsah, hätte auffallen können, dass die Reifen des Fahrrads eine Idee zu breit waren und der Rahmen eigenartige Nahtstellen aufwies.
Niemand schaute so genau hin. Die Menschen hatten andere Sorgen.
Aufgehalten wurde er selten, und selbstredend war er auf so einen Fall vorbereitet. Seine Geschichten waren stimmig, und die legendäre Ruhe, die er ausstrahlte, überzeugte nicht nur Basler Grenz- oder Zollbeamte. Wenn er auch sehr darauf achtete, nicht unbedingt den germanisierenden Beamten des Reichs in die Hände zu fallen.
An diesem Tag war es auffällig still im Grenzbereich. Wirklich gewundert hatte er sich nicht darüber. Man hatte schon angedeutet, dass er mit nur wenig Grenzverkehr zu rechnen habe, was ihn noch ruhiger hatte erscheinen lassen. Obwohl diese zur Schau gestellte Gelassenheit gelegentlich an Leichtsinn grenzte, war er auch diesmal wieder gut damit gefahren.
Grundsätzlich war es ihm gleichgültig, ob das Elsass, vormals Alsace, nun von Paris oder von Berlin aus regiert wurde, weil er beides gleichermassen verabscheute und er, wie viele in dieser Region, sowieso nur eine Regierung in Strassbourg, nunmehr Strassburg, akzeptiert hätte.
Es hatte aber nicht lange gedauert, und Jean, der sich jetzt Hans nennen musste, nur der Nachnahme konnte bleiben, war klar geworden, dass es da schon Unterschiede gab. Spätestens als einige der Genossen in Natzwiller verschwunden waren und einige der alten Gefährten eine engere Bindung an Berlin für nicht mehr so abwegig hielten.
Da hatte er sich verstärkt an der illegalen Parteiarbeit beteiligt und war mit seinem etwas modifizierten Fahrrad des Öfteren zwischen der Schweiz und Frankreich hin- und hergependelt.
Das Fahrrad hatte immer wieder etwas mehr oder weniger Gewicht, und das lag nicht nur an den Zigaretten, die sich Jean bei diesen Gelegenheiten besorgte, um seinen beachtlichen Konsum damit zu decken. Die waren so gut versteckt wie manch anderes Material, das nicht wenige wesentlich mehr interessiert hätte als seine Leidenschaft für den blauen Dunst.
Dass er trotzdem an diesem Vormittag eher etwas misslaunig war, lag in erster Linie daran, dass der Auftrag die Eiserne Hand betraf und damit fast zwangsweise mit dem alten Heimer zu tun hatte. Den hatte er gefressen, seit es mehr als nur ein Gerücht war, dass der gelegentlich auch bei den Braunen mitmischte.
Jean war immer für Klarheit gewesen, und eine geteilte Loyalität war ihm widerlich. Der Teufel sollte den Heimer holen.
Dass sie ihn in Zukunft da draussen lassen sollten, hatte er seinen Leuten klar gemacht. Wo der Heimer seine Finger im Spiel hatte, brauchten sie mit ihm nicht mehr zu rechnen.
Man hatte ihm aber versichert, dass er mit dem Alten keinen direkten Kontakt haben würde. Hatte ihm erklärt, wo, wann und mit wem er sich bei dieser Aktion treffe und bei dieser Gelegenheit auch klar gemacht, dass man jetzt öfter Ortsfremde einsetze, weil das unter dem Strich mehr Sicherheit bedeutete. Wer die Strukturen nicht kannte, konnte sie auch nicht verraten. Halt wieder eine dieser verrückten Ideen, aus der Not geboren, wie er fand.
Ganz eingesehen hatte er das immer noch nicht, aber ganz eingesehen hatte er so manches nicht, was da von der noch übriggebliebenen Parteispitze ausgeheckt wurde. Andererseits musste man ihm aber auch nicht erklären, wie schwierig es geworden war, noch Mitstreiter für eine Sache zu finden, bei der man Kopf und Kragen riskierte und schneller in einem KZ landen konnte, als zwei Zigarettenzüge getan waren. Eine Sache, an deren Sinn und Erfolg zu glauben immer schwerer fiel, je länger sich diese Braunhemden überall festgesetzt hatten.
Dass der Heimer einst ein zuverlässiger Genosse gewesen war, auf den man sich unbedingt hatte verlassen können, ein Kerl, der weder Tod noch Teufel und bestimmt keine Nazis fürchtete, der auch immer wieder den Kopf hingehalten und manchen Genossen rausgehauen hatte, mochte eine Rolle gespielt haben.
Wegen der alten Zeiten hatte er sich am Ende breitschlagen lassen. Hatte sein altes Gefährt genommen und sich auf den Weg gemacht, oft in Sichtweite der alten Grenzsteine. War dem alten Grenzweg gefolgt und hatte unweit des 1700-Grenzsteins gut getarnt auf das Vreneli gewartet.
Und das kam nicht.
Da hatte er Zigarette um Zigarette geraucht und gewartet und gewartet, an seine Frau gedacht, die in der Nacht davor wieder einmal im Schlaf aufgeschreckt war und an die Wand gestarrt hatte. Seit sie den Sohn eingezogen hatten, geschah das immer häufiger. Er hatte damals noch versucht, ihn zum Abhauen zu bewegen, obwohl klar war, was das für die ganze Familie bedeutet hätte.
Jacques Metz, jetzt Jakob Metz bei der Reichswehr.
Seit Monaten schon war er im Osten. Gelegentlich erhielten sie Postkarten. Ewig dauerte es, bis sie ankamen.
«Besser weit weg im Osten, als im Westen auf die eigenen Leute zu schiessen.» Hatte der Sohn zu ihm gesagt, als er ihn zum letzten Mal gesehen hatte.
Dafür waren sie jetzt Reichsdeutsche, ganz offiziell. Pass, Ausweis, alles korrekt.
*
Er hatte eine beachtliche Zahl Zigaretten geraucht, als er dann doch Schritte auf dem Waldboden hörte. Im Wald lag sehr viel weniger Schnee als auf den offenen Feldern, und die Schritte wurden deshalb nicht gedämpft.
Von Ferne sah er ihren roten Schopf und dachte noch, es wäre besser gewesen, wenn sie ihren Kopf mit einem Kopftuch bedeckt hätte. Solche Haare eignen sich nicht für dieses Geschäft.
Viel geredet hatten sie nicht. Auch weil das Vreneli ziemlich blass aussah. Er hatte sie nicht einmal gefragt, warum sie so lange nicht gekommen war. Man konnte sehen, dass es ihr nicht gut ging.
Immerhin waren ihr noch die Zigarettenstummel aufgefallen, die er achtlos auf den Waldboden hatte fallen lassen. Sie hob sie allesamt auf, steckte sie in eine kleine Schachtel, die sie in ihrem Mantel verbarg.
Jean lachte trocken, als er ihr dabei zusah und sich gleichzeitig an seinem Fahrrad zu schaffen machte, den Rahmen auseinandernahm und die Reifen von den Felgen löste.
«Hast du Angst, dass den Schweizern der Wald abbrennt?»
«Weniger», meinte das Vreneli. «Da brennt vielleicht bald ganz anderes. Aber was denken die Grenzpatrouillen, wenn die hier so einen Haufen Kippen finden»?
Darauf ging Jean nicht ein, zog sorgfältig Papier um Papier aus dem Rahmen und übergab es der jungen Frau, die es in der Innenseite ihres weiten Mantels versteckte.
Gleichzeitig übergab sie dem Elsässer einiges an Material, das aus eben diesen Tiefen ihrer Taschen kam.
Als er sein Fahrrad wieder zusammengebaut hatte, meinte Jean, dass es in Zukunft wohl kaum mehr solche Gelegenheiten für Treffen dieser Art geben würde.
«Tote Briefkästen», sagte er noch und schob sein Fahrrad wieder in Richtung Riehen, «nurmehr tote Briefkästen, zu mehr wird es nicht reichen!»
Dann stieg er auf und radelte davon.
Die junge Frau liess er am 1700-Grenzstein zurück.
*
Die Schmerzen im Kopf waren auf dem Rückweg nicht besser geworden. Dennoch war er für sie weniger anstrengend. Sie vergass keinen Weg, den sie schon einmal zurückgelegt hatte. Oft musste sie nur den eigenen Spuren folgen.
Als sie glaubte, in etwa auf Höhe des Durchgangs im Zaun zu sein, musste sie sich ein wenig orientieren. Hier im Wald waren keine Spuren mehr zu sehen.
Sie war sich darüber im Klaren, dass sie spät dran war. Der Junge würde vielleicht schon fort sein. Aber das wäre so schlimm nicht gewesen. Sie wusste, wo sie den Alten finden würde.
Als sie fast sicher war, nicht mehr weit von der Stelle zu sein, an der sie den Jungen zurückgelassen hatte, ein paar Meter hinauf noch und dann nach links abbiegen, wurde die kalte Stille plötzlich durch knackendes Geäst in einiger Entfernung durchbrochen. Ihr war, als vernehme sie ein kurzes Lachen, Stimmen, die aber undeutlich blieben.
Sofort blieb sie stehen und lauschte angespannt. Obwohl sie ein ganzes Stück zwischen den laublosen Bäumen in den Wald hineinschauen konnte, war nichts zu erkennen.