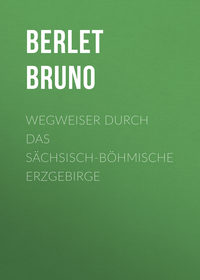Raamatut ei saa failina alla laadida, kuid seda saab lugeda meie rakenduses või veebis.
Loe raamatut: «Wegweiser durch das sächsisch-böhmische Erzgebirge»
Vorwort
Seit Jahren war mündlich und schriftlich die Klage zu vernehmen, dass es an einem brauchbaren Reisehandbuche für das sächsisch-böhmische Erzgebirge fehle. Der Unterzeichnete meinte, ein recht Berufener werde schon diesem Mangel abhelfen; da dies aber nicht geschah, so musste er sich selbst an's Werk machen. Freilich ward er bei Ausarbeitung des Schriftchens bald inne, dass die Schwierigkeit, von einer Landschaft und deren Bewohnern überhaupt das Wichtigste und Charakteristische hervorzuheben, sich bei dem Erzgebirge noch steigerte, weil hier ausser der Bodengestaltung und den üblichen wirthschaftlichen Interessen noch ein ungemeiner Reichthum an industriellen Beziehungen und eine kaum wiederherzufindende Mannichfaltigkeit der gewerblichen Verhältnisse in Frage kam. Doch scheute er keine Mühe, die entgegentretenden Schwierigkeiten zu überwinden und etwas nur einigermassen Befriedigendes zu Stande zu bringen.
Treffliche Dienste leisteten hierbei: Leupold's Wanderbuch durch Sachsen, Elfried's von Taura Wanderung durch's Erzgebirge, Sigismund's Lebensbilder vom sächsischen Erzgebirge und Engelhardt's Vaterlandskunde vom Königreiche Sachsen. Nichtsdestoweniger war etwas Vollständiges oder gar Erschöpfendes – namentlich in unserer Alles umgestaltenden Zeit, wo der Wechsel rasch wieder einen Wechsel und das Neue bald wieder ein Neues gebiert – nicht zu leisten, auch werden in dem Gegebenen noch mehrerlei Versehen und Unrichtigkeiten enthalten sein. Der freundliche Leser möge beides entschuldigen! Indess kann der Verfasser für eine etwaige 2te Auflage die Ergänzung manches Mangels und die Richtigstellung mancher Ungenauigkeit versprechen, da ihm von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Theilen des Erzgebirges eine aufmerksame Durchsicht und Prüfung des »Wegweisers« zugesagt worden ist.
Die Höhenangaben sind meist aus H. Lange's Atlas von Sachsen entnommen und beziehen sich bei Ortschaften immer auf die Lage der Hauptkirche. Die beigebogene Reisekarte ist ein Werk meines werthen Kollegen, des Herrn Oberlehrers Göpfert.
Der Verfasser würde sich freuen, wenn der »Wegweiser« vielen Reisenden zu einer angenehmen – Erholung und Belehrung gewährenden – Tour im Erzgebirge verhülfe und die Einheimischen merken liesse, dass ihm bei Ausarbeitung des Schriftchens die »Liebe zum Erzgebirge« zur Seite gesessen.
Annaberg, im April 1872.
B. Berlet.
Einleitung
Fremdenbesuch. – Das Erzgebirge ist bislang fast nur von Geschäftsreisenden und solchen Leuten besucht worden, die mit möglichster Schnelle durch Sachsen nach den böhmischen Kurorten eilten. Erst neuerdings sieht man zur Sommerzeit auf Strassen und Pfaden, in Thälern und auf Höhen Wanderer mit Seitentasche, Plaid und handfestem Regenschirm – sogenannte Touristen. Der Grund für die frühere Vernachlässigung des Erzgebirges mag einestheils darin gesucht werden, dass die Reiselust vormals überhaupt nicht so gross war, als heut zu Tage, und anderntheils darin, dass bis zur Eröffnung der erzgebirgischen Eisenbahnen diese Landschaft dem Fremden als schwer zugänglich erschien; wahrscheinlich aber hat dazu auch die Beschaffenheit des Gebirges mit beigetragen. Denn der Verfasser »der Lebensbilder aus dem Erzgebirge« hat Recht, wenn er sagt: »Der Harz hat des Wilden und Schaurigschönen unvergleichlich mehr als das Erzgebirge, auch ist dieses nicht ein süsses, anmuthiges Idyll, wie der Thüringer Wald.« Trotzdem findet sich im Erzgebirge genug des Schönen, sind doch Berg und Thal traulich und gemüthlich, wenn auch nicht gross und wild angelegt! Freilich bietet sich das Sehenswerthe hier nicht so von selbst dar und ist nicht auf einem engen Raum vereinigt; es will vielmehr gekannt und aufgesucht sein. Wer sich daher an der erzgebirgischen Landschaft laben will, darf sich nicht begnügen, nach Besuch guter Aussichtspunkte, die Thäler auf den angelegten Heerstrassen zu durchkreuzen, sondern muss sie flussaufwärts durchwandern; erst dann wird er deren Annehmlichkeiten inne werden. Das Muldenthal von Zwickau bis Schwarzenberg, das Zschopauthal von Flöha bis Annaberg zeigen schon von den Wagen der Eisenbahn, welche eifrigst den Windungen der Flüsse folgt, saftige Wiesen, schattige Wälder und reizend gelegene Ortschaften! Und überdies hat das Erzgebirge noch etwas vor den andern deutschen Mittelgebirgen voraus: es wird von einem fleissigen und anstelligen Völkchen bewohnt und ist der Sitz einer hervorragenden Industrie. Die Fabrik im stillen Thal, das Kunstgezeug auf rauher Höh', jedes Dörfchen, jedes Städtchen wird solches bezeugen! Ueberhaupt kann man in keinem Gebirge die Betrachtung des Gewerbefleisses so mit der Freude an der Natur – mithin das Nützliche so mit dem Angenehmen verbinden, als im Erzgebirge. Für Lehrer und Schüler, für Polytechniker und Bergstudenten, überhaupt für alle die, welche neben der Schönheit der Landschaft auch die gewerblichen Leistungen der Bewohner kennen lernen wollen, ist keine Reise mehr zu empfehlen, als die ins Erzgebirge.
Reisezeit. – Die günstigste Zeit zum Bereisen des Erzgebirges ist von Mitte Juni bis Ende September; letztgenannter Monat hat gewöhnlich die reinste Luft und die beständigste Witterung, auch zeigt sich in ihm eine Eigenthümlichkeit des Gebirges am besten: während im Niederlande Felder und Bäume schon kahl erscheinen, sind sie im Obergebirge noch mit frischem Grün bedeckt.
Sonnen-Auf- und Untergang. – Die Zeit des Sonnen-Auf- und Untergangs stellt sich in den Monaten Juni bis October folgendermassen:

Die beste Aussicht auf Höhepunkten wird man im Frühsommer zwischen 6 und 7, im Spätsommer zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags haben.
Reisekleidung. – Die Kleidung sei dauerhaft und praktisch. Am geeignetsten ist ein wollener Anzug von nicht zu knappem Schnitt und nicht zu heller Farbe. Ausser der nöthigen Wäsche wird man alsdann einen Filzhut mit breiter Krämpe und Sturmband, einen nicht zu kleinen Regenschirm und bequemes Schuhwerk – womöglich derbe kalblederne Stiefel mit Doppelsohlen – nöthig haben. Weil es auf Bergen, die den Brocken an Höhe übertreffen, selbst im August oft empfindlich kühl ist, so versehe man sich endlich mit einem guten Plaid oder mit einem leichten Ueberzieher; nach Sonnenuntergang wird man fast immer Veranlassung haben, davon Gebrauch zu machen. – Wer mehr fährt als geht, kann sich neben dem leichten noch ein wärmeres Gewand mit nehmen; will der Tourist einen Reserveanzug haben, so muss er ihn gut verpacken und mit der Post von Hauptstation zu Hauptstation voraussenden.
Reiseutensilien. – Die aus Leder oder wasserdichtem Baumwollenzeug gefertigte Seitentasche habe – wie die Bädekersche Reisetasche – unten zwei Ringe, so dass sie durch Hindurchziehen des Tragbandes leicht zum Rückentornister umgewandelt werden kann. Der Plaid wird entweder mittelst eines Lederriemens auf die Reisetasche geschnallt, oder zusammengerollt über die Schulter gehangen. Der Handstock sei fest und mit guter Zwinge versehen; in neuerer Zeit hat man starkstabige Regenschirme, welche bequem die Stelle des Stockes vertreten können. Die Reisetasche enthalte ausser der Wäsche einen ledernen, zum Zusammenklappen eingerichteten Trinkbecher, ein Stück Seife, Scheere, Nadel und Zwirn, etwas Bindfaden und – um für alle Fälle gerüstet zu sein, – ein Fläschchen mit Opiumtinctur. Dann trage man ein Messer und ein Etui voll Streichhölzer bei sich und nehme von Station zu Station etwas Semmel oder Brod und einen Schluck Rum oder Kirschwasser mit. Die Semmel ist bestimmt, vor Heisshunger zu schützen und das geistige Getränk dazu, durch Beimischung kaltes Gebirgswasser trinkbar zu machen.
Geld. – In Sachsen wird nach Thalern, Neugroschen und Pfennigen (1 Thlr. = 30 Neugr., 1 Ngr. = 10 Pf.), in Böhmen nach Gulden und Neukreuzern (1 Gulden = 100 Neukreuzer) gerechnet. Sächsischerseits werden übliche Münzsorten und Cassenscheine ohne Beanstandung genommen; in Böhmen thut man wohl, mit österreichischen Banknoten zu bezahlen, die man in jeder Grenzstadt einwechseln1 kann.
Reisekosten. – Im Erzgebirge ist es nicht theurer als in anderen Gegenden Mitteldeutschlands; doch lebt man auf böhmischer Seite billiger als auf sächsischer Seite. Die Gasthöfe in den grösseren und kleineren sächsischen Städten sind gut; öfters ausgezeichnet; in Böhmen muss man sich schon an grosse Ortschaften halten und auch da ein aufmerksames Auge für Betten und Bettwäsche haben. In Sachsen trinkt man fast überall ein gutes Lager- und bayrisches Bier; das »böhmische« Bier ist heller und leichter, aber gesund und schmackhaft. Wein soll man nur in den besseren sächsischen Gasthäusern verlangen; in Böhmen erhält man dagegen schon in kleineren Restaurationen preiswürdigen österreichischen und Ungarwein; nur begehre man da ja nicht Rhein- oder überhaupt ausländischen Wein, denn der ist mittlerer Beschaffenheit und sehr theuer. Kaffee und Gebäck sind in Böhmen musterhaft. – Im Herbste bieten beide Theile des Gebirges Reichthum an Wildpret, wie Hasen, Rehe, Krammetsvögel und Rebhühner; auch erhält man in den höher gelegenen Gegenden fast allerwärts treffliche Forellen. – Die täglichen Reisekosten richten sich selbstverständlich nach den Ansprüchen und Gewohnheiten eines Fremden: wer in den ersten Hôtels wohnt, mit schweren Koffern reist und viel Aufmerksamkeiten verlangt, wird täglich 4–6 Thlr. brauchen, während der Fusswanderer, der sich nur halbwege beschränkt, mit 1–2 Thlr. auskommt.
Transportmittel. – Unter grossen Anstrengungen ist es dem Erzgebirge gelungen, sich mehrere Eisenbahnen zu verschaffen. Ein Schienenstrang geht am Fusse des Nordabhangs von Dresden über Freiberg und Chemnitz nach Zwickau, zweigt die Linie Chemnitz-Hainichen ab und sendet zwei Ausläufer: Chemnitz-Annaberg und Zwickau-Schwarzenberg in das Herz des Gebirges. Von Zwickau braust die Locomotive, Reichenbach, Falkenstein und Oelsnitz berührend, über den Rücken des Gebirges nach Eger. Und im Egerthale geht der eherne Weg westlich von Eger bis Karlsbad und östlich von Aussig über Teplitz nach Kommotau (Priesen). Ausserdem sind mehrere Linien im Bau begriffen und sehen in den Jahren 1871 und 1872 ihrer Eröffnung entgegen: so Annaberg-Weipert-Kommotau; Kommotau (Priesen) – Karlsbad und Dux-Bodenbach; andere Linien sind projectirt und werden bald begonnen werden, wie Nossen-Freiberg, Aue-Jägersgrün und Chemnitz-Marienberg-Kommotau, und noch andere befinden sich in den Vorbereitungsstadien, wie Freiberg-Dux und Schwarzenberg-Karlsbad.
Ausser den fertigen Eisenbahnen stehen dem Reisenden noch zahlreiche Fahrposten, die zwischen den Städten meist täglich mehrmals verkehren, zu Gebote; auch sind fast überall Miethgeschirre zu haben.
Pass und Mauth. – Seit 1860 gilt auch in Oesterreich eine Passkarte als hinreichende Reiselegitimation. – Die Untersuchung des Gepäcks beim Ueberschreiten der böhmischen Grenze geschieht mit Höflichkeit und besteht oft nur in der Anfrage, ob der Reisende etwas Zollbares habe. Zu versteuern sind alle ungebrauchten Sachen; nicht übergeführt werden dürfen: Spielkarten, Kalender und versiegelte Briefe; Bücher, ausser Reisehandbüchern, können Unannehmlichkeiten bereiten. An Tabak hat der Reisende gegen 2 Loth und 1 °Cigarren frei; im Uebrigen muss das Pfund Tabak mit etwa 1 Fl., das Pfund Cigarren mit 3 Fl. verzollt werden. Der Tabak ist in Oesterreich Monopol und wird nur in sogenannten Trafiks verkauft; Cigarren sind theuer und nicht sehr behaglich.
Gasthausregeln. – Ohne Noth treffe man nicht zu spät, jedenfalls vor einbrechender Dunkelheit in seinem Nachtquartier ein. Sobald man ein Zimmer bezogen hat, untersuche man den Zustand des Bettes und der Bettwäsche. Bedarf man irgend einer Auskunft, so wende man sich nicht an das untergeordnete Dienstpersonal, sondern an den Wirth selbst, und wenn dieser »unsichtbar« sein sollte, an den Oberkellner. Bei längerem Aufenthalte mag man alle 2–3 Tage die Rechnung bezahlen, jedoch zuvor deren Inhalt und Summe prüfen, da sich »Irrthümer« gar leicht einschleichen. Will man am andern Morgen früh weiterreisen, so fordere man am Abend vorher die Rechnung, berichtige sie jedoch nebst den Trinkgeldern erst beim Weggehen.
Sommeraufenthalt. – Als Sommerfrischen sind bisher nur die erzgebirgischen Bäder Grünthal, Hohenstein, Schwarzenberg, Wiesenbad und Wolkenstein benutzt worden, doch eignen sich dazu auch Erdmannsdorf bei Augustusburg und besonders Olbernhau.
Fussreisen. – Zu Wanderungen verwendet man nicht neues, sondern schon etwas getragenes Schuhwerk. Wer mit den Fussnägeln Mühe hat, muss dieselben einige Tage vor der Reise in besondere Pflege nehmen, sie mässig beschneiden und etwa zu starke Nägel nach einem Fussbade in überschlagenem Wasser (17–18° R) wiederholt mit einem Glasstücke etwas dünner schaben. Auf der Reise selbst wird früh aufgebrochen und die grössere Hälfte des Weges Vormittags zurückgelegt. Während der Mittagsstunden, d. i. vor und nach der Mittagsmahlzeit, sei Rast. In den ersten Reisetagen stelle man seine physischen Kräfte nicht auf eine zu harte Probe; später kann man grössere und anstrengendere Touren zurücklegen. Beim Marschiren hat sich von jeher die Regel bewährt, dass man gleichmässig und nicht zu schnell ausschreite, sich aber auch nicht zu oft der Ruhe hingebe, sondern in möglichst abgemessenen Entfernungen pausire. Auf solche Art geräth Puls und Lunge in nicht zu schlimme Aufregung. Bergan wähle man daher ein langsames Tempo: ein von Anfang an gleichmässig anhaltender, wenn auch gemächlicher Schritt, bringt schneller und besser zum Ziele, als zu grosse Hast. Auf einer Höhe angelangt, werde der Rock fest zugeknöpft und der Plaid umgehangen; findet man droben ein Wirthshaus, so kühle man sich darin durch langsames Herumgehen eine Viertelstunde ab; erst dann setze man sich der Zugluft aus. Jeder rasche Uebergang von grosser Anstrengung zur Ruhe – wie das plötzliche Niederlegen nach starken Tagesmärschen – ist zu vermeiden. Die Abkühlung will angebahnt, die Ruhe vermittelt sein; fühlt man sich dann ja einmal sehr erschöpft, so wird Waschen mit kaltem Wasser, Einreiben der Waden und Füsse mit Kornbranntwein oder Rum gute Dienste leisten. Sind die Füsse wund geworden, so bestreiche man sie mit Hirschtalg, doch werden auch einige Tropfen Collodium hierbei, wie auch bei Schnittwunden, erfolgreich wirken. Blasen dürfen nicht aufgeschnitten, sondern nur vermittelst einer Nadel mit wollenem Faden durchzogen werden.
Reisepläne. – Die später mitgetheilten Reisepläne sollen für den Wanderer nichts als unmassgebliche Vorschläge sein, doch werden sie ihm das Material bieten, sich eine seiner Zeit und Absicht entsprechende Tour zusammenzustellen. Die Bereisung des ganzen Erzgebirges erfordert 3–4 Wochen. Als geeigneter Eintrittspunkt ist im Osten Dresden, im Westen Zwickau und im Centrum Chemnitz zu empfehlen. Interessante Ausflüge lassen sich von jedem erzgebirgischen Orte aus machen. Die angegebenen »Nebentouren« werden am besten in Döbeln begonnen.
Damit der »Wegweiser durch's Erzgebirge« nicht zu stark und theuer wurde, musste die Beschreibung der einzelnen Routen und Ortschaften etwas knapp gehalten werden; eben darum wurden etwaige Sagen nur angedeutet, nicht ausführlich mitgetheilt.
Das Erzgebirge
1. Ausdehnung und Gestaltung. – Das Erzgebirge ist ein mächtiger 18–20 Meilen langer Gebirgszug des mittleren Deutschland. Bei ostnordöstlicher Richtung erstreckt es sich von den Quellen der (weissen) Elster, wo es durch das voigtländische Hügelland mit dem Frankenwalde und dem Fichtelgebirge zusammenhängt, bis zu den Quellen der Gottleuba, wo es in das Elbsandsteingebirge übergeht. Im Süden fällt es steil wie eine Mauer ab und findet seine Begrenzung bis Kaden durch die Eger und, nach der kurzen Strecke Kralup-Kommotau-Görkau, durch den Bielafluss, welcher über Brüx, Bilin und Aussig der Elbe zurinnt. Im Norden dacht es sich allmälig zum sächsischen Tieflande ab, wobei Hügelwelle hinter Hügelwelle erscheint und das ganze Gelände sich als eine von vielen Flussfurchen durcharbeitete Berglehne darstellt.
2. Eintheilung. – Der Hauptrichtung nach zerfällt das Erzgebirge in 3 Theile: in das westliche, in das Central- und in das östliche Erzgebirge. Das westliche Erzgebirge liegt zwischen der oberen Elster und dem Schwarzwasser, beziehentlich der Zwickauer Mulde; das Central-Erzgebirge zwischen dem Schwarzwasser und der Freiberger Mulde und das östliche Erzgebirge zwischen der Freiberger Mulde und der Gottleuba, beziehentlich der Elbe.
In der Richtung von Süd nach Nord unterscheidet man das obere und das niedere Erzgebirge; jenes reicht von dem zusammenhängenden Kamme, der eine durchschnittliche Höhe von 2500 Fuss hat, etwa bis Falkenstein, Schneeberg, Thum, Wolkenstein, Frauenstein und Schmiedeberg; dieses von den genannten Orten bis in die Gegend von Zwickau, Lichtenstein, Chemnitz, Frankenberg, Hainichen, Siebenlehn und Tharandt. – Im Centralgebirge kommt der jähe Absturz des Kammes nach Süden und die sanfte Abdachung nach Norden am meisten zur Geltung.
3. Gebirgsarten. – Das Erzgebirge besteht vornehmlich aus Urgebirgsarten, d. h. aus Thon- und Glimmerschiefer, Gneis und Granit. Am verbreitetsten zeigt sich der Gneis. Er ist nicht nur vorherrschend im ganzen östlichen Gebirge, sondern reicht auch weit in's Centralgebirge hinein, und zwar bis Schlettau, Wolkenstein und Schellenberg. Ihm sind zugleich die wichtigsten Erzgänge2 eingelagert, welche von dem sächsischen Bergmanne abgebaut werden. Am mächtigsten ist darnach der Glimmer- und Thonschiefer. Diese Gebirgsarten bilden besonders den südwestlichen Theil des Gebirges und den Südrand des Steinkohlenbeckens zwischen Zwickau und Chemnitz. Das dritte Gestein, der Granit, tritt nur an mehreren Stellen aus dem Glimmer- und Thonschiefer heraus und hat seine grösste Ausdehnung um Eibenstock und Kirchberg. Ausser diesen Hauptgebirgsarten zeigt sich an mehreren Orten Porphyr, Syenitporphyr und Quadersandstein; wie denn auch der häufig vorkommende Basalt daran erinnert, dass im Erzgebirge einst bedeutende vulkanische Durchbrüche stattgefunden haben.
4. Berge. – Auf dem Rücken des Erzgebirges erheben sich mehrere Gipfel, welche zum Theil an Höhe sogar die obersten Spitzen des Thüringer Waldes und des Harzes übertreffen. Wenn sie trotzdem nicht so gewaltig als diese erscheinen, so hat dies seinen Grund darin, dass sie auf einer sehr hohen Unterlage ruhen.
Als die ansehnlichsten, aus Urgebirge bestehenden Gipfel sind zu nennen: der Keilberg und der Fichtelberg bei Oberwiesenthal (jener 3812, dieser 3708 P. F. hoch); der Spitzberg bei Gottesgabe (3444´), der Eisenberg bei Unterwiesenthal (3166´), der Auersberg bei Wildenthal (3120´), der Hirschkopf bei Karlsfeld (2992´), der Rammelsberg bei Sachsenberg (2972´), der Wieselstein bei Langewiese (2944´), der Kahlberg bei Altenberg (2803´), der Kupferhügel bei Kupferberg (2790´), der Lugstein bei Zinnwald (2752´), der Schneckenstein bei Gottesberg (2690´), der Rabenberg bei Johanngeorgenstadt (2636´), der Eselsberg bei Sosa (2635´), die Morgenleite bei Schwarzenberg (2488´), der Kuhberg bei Stützengrün (2426´), der Schwartenberg bei Seifen (2394´), der Kapellenberg bei Schönberg (2337´), die Tellkuppe bei Bärenburg (2323´) und der Greifenstein bei Geyer (2234´).
Daneben giebt es mächtige Basaltberge, welche als hohe, freistehende Pyramiden oder Kegel erscheinen. Wir erwähnen: den Hassberg bei Pressnitz (3051´) den Bärenstein bei Weipert (2762´), den Pöhlberg bei Annaberg (2567´), den Geising bei Altenberg (2534´), den Scheibenberg bei der gleichnamigen Stadt (2470´), den Spitz- oder Sattelberg bei Schönwald (2235´), den Luchberg bei Glashütte (1782´) und den Wilisch bei Reinhardsgrimma (1466´). – Eine schöne Aussicht gewähren ausser den genannten Bergen noch: der Reischberg bei Pressnitz, die Luisensteine bei Brandau, der Glöselsberg bei Niklasberg, das Mückenthürmchen bei Graupen (2511´), die Nollendorfer Höhe bei Peterswalde (2142´), der Stein in Schöneck (2301´), Schloss Augustusburg, die Schönerstädter Höhe bei Oederan, die Saydaer Höhe, die Burgruine Frauenstein, der Burgberg bei Lichtenberg und die goldene Höhe zwischen Dippoldiswalde und Dresden (1054´).
5. Waldungen. – Reichlich die Hälfte des Erzgebirges ist mit Wald bedeckt. Die grössten Forste befinden sich in den Revieren Auerbach, Schöneck, Schwarzenberg und Crottendorf. Vorherrschend ist Nadelholz; doch treten neben Fichtenwald zusammenhängende Buchenbestände auf: so bei Tharandt, Olbernhau, Marienberg und Steinbach. Der grösste Theil der Waldungen ist Eigenthum des Staates und wird musterhaft bewirthschaftet.
6. Flüsse. – Das Erzgebirge ist der Quellort für zahlreiche Flüsse, Flüsschen und Bäche, welche allesammt dem Elbgebiete angehören. Die wenigsten von ihnen haben den Abfluss nach Süden, wie die Zwota und Biela; bei weitem die meisten rinnen nach Norden und münden unmittelbar in die Elbe, wie die beiden Mulden als vereinigte Mulde, die Weisseritz, Müglitz und Gottleuba, oder fallen zuvor in die Saale, wie die Elster und Pleisse, oder in die Mulden, wie alle übrigen.
Die nordwärts laufenden Gewässer haben beim Herabgleiten die im Boden vorhanden gewesenen Spalten nach und nach erweitert und zahlreiche Vertiefungen und Kessel, Gründe und Thäler gebildet und so der Landschaft besondere Reize verliehen. Am anmuthigsten sind die Thäler der Elster, der Zwickauer Mulde, des Schwarzwassers, der Sehma, der Zschopau und der Müglitz; am wildesten die der schwarzen Bockau im schwarzen Grund bei Pobershau und der rothen Weisseritz im Rabenauer Grunde.
7. Klima. 3 – Während gewöhnlich die Temperatur von Norden nach Süden zunimmt, ist es im Erzgebirge wegen des Ansteigens des Bodens umgekehrt. Dieser Umstand wirkt ungünstig auf das Klima ein. Engelhardt's Vaterlandskunde von Sachsen sagt: »Lange Winter mit viel Schnee, späte Einkehr des Frühlings und rascher Uebergang aus diesem zum Sommer, schöner klarer Herbst, Spätfröste noch im Mai, frühzeitige schon im September – das sind die Hauptkennzeichen des Klimas; ganz wesentlich hat jedoch zu dessen Verbesserung die Entwässerung der Sümpfe beigetragen.« Dabei sind aber die Thäler mild und die Höhen eigentlich nur wenig kälter, als die entsprechenden anderer deutschen Mittelgebirge. Auch ist die Luft leicht und rein und für Brustkranke, deren Leiden noch nicht zu weit fortgeschritten, sehr zuträglich. Cholera ist dem obern Erzgebirge bisher fern geblieben, und Wechselfieber gehören allda zu den seltensten Fällen.
Für das erzgebirgische Klima spricht auch, dass der Getreidebau bis weit in die Berge hinauf reicht. Bei einer Höhe von 1800 bis 2000 Fuss erntet man noch Raps, Roggen und Weizen; am rauhen Gebirgskamme, wie bei Gottesgab und Oberwiesenthal, allerdings nur Hafer, Flachs und Kartoffeln. Am ergiebigsten zeigen sich die Kartoffeln. Sie sind auch gegen Ende des 17. Jahrhunderts zuerst in dem Dorfe Würschnitz bei Adorf angebaut und von dort aus erst später weithin verbreitet worden. – Wer Näheres über die Pflanzenwelt des Erzgebirges wissen will, dem empfehlen wir: Dr. Stössner: Die Vegetationsverhältnisse von Annaberg und Umgegend, Annaberger Realschulprogramm vom Jahre 1859; A. Israel: Schlüssel zum Bestimmen der bei Annaberg und Buchholz wild wachsenden Pflanzen, und O. Wünsche: Excursionsflora für das Königreich Sachsen.
8. Einwohnerzahl und Staatsangehörigkeit. – Das Erzgebirge gehört zu den dicht bevölkertsten Gegenden Sachsens, ja Deutschlands. Was urbar zu machen war, hat man urbar gemacht; man verfuhr nach dem Grundsatze: »Wo der Pflug kann gehn, soll der Wald nicht stehn!« und half, wenn der Pflug wegen der Steilheit des Bodens doch nicht gehen konnte, auch noch mit Grabscheit und Hacke nach. Daher findet man, wo man schlichte Bauerndörfer vermuthet, ansehnliche Städte, und wo man in waldigem Thal kleine Weiler voraussetzt, langgedehnte Dörfer. Dabei hat jedes Haus zahlreiche Insassen: auf die Quadratmeile kommen im Gebirge eben mehr als 10,000 Einwohner.
Die Bevölkerung des Erzgebirges erscheint viel gleichartiger als die von anderen deutschen Mittelgebirgen. Abgesehen von der geringen Gliederung des Bodens, welche ein Abschliessen nicht begünstigt, und von dem regsamen Handel, welcher unwillkürlich ein Annähern der Leute herbeiführt, trägt dazu sicherlich bei, dass die Landschaft nur zwei Staaten angehört und dadurch einen angenehmen Gegensatz zu Thüringen und dem Harze bildet, wo die politischen Grenzen so merkwürdig ausgezackt und vielfach verschlungen sind. Der Südabhang des Erzgebirges und ein Theil des Kammes gehören zu Böhmen, der andere Theil des Kammes und die Nordabdachung zu Sachsen. Dabei stellt die staatliche Grenze zugleich die Scheidung zweier Kirchengebiete dar: wer aus dem protestantischen Sachsen über die böhmische Grenze schreitet, wird an den errichteten Kreuzen und Heiligenbildern bald merken, dass er auf gut katholischem Boden wandert.
9. Menschenschlag. – Der erzgebirgische Menschenschlag ist ein ursprünglich kräftiger, wie man ihn heute noch am Südabhange und in den Wald- und Ackerbaudistrikten antrifft; in den Fabrikgegenden aber ist er durch Stubenarbeit oder allzu geringe Nahrung, welche fast nur aus Kartoffeln und dünnem4 Kaffee besteht, mehrfach verkümmert.
10. Volkstracht. – Eine eigentliche Volkstracht ist im Erzgebirge nicht mehr vorhanden. Namentlich auf der nördlichen Seite »hat die Kultur fast Alles beleckt« und die Mode beinahe jedes altväterische Kleidungsstück beseitigt. Unter den Männern haben nur die Bergleute noch einen besonderen Anzug und unter den Frauen tragen nur die Bäuerinnen, welche in den entlegensten Dörfern wohnen, noch faltenreiche Röcke und steife Haubenschleifen oder glatte Pelzmützen.
11. Volkscharacter. – Der Erzgebirger ist höflich, gefällig und äusserst genügsam. Gern steht er dem Fremden Rede und im Zwiegespräch sucht er unaufgefordert das Beste zur Unterhaltung beizutragen. Von seiner Genügsamkeit zeugen die einfache Wohnung und die noch einfachere Kost. Dazu kommt Frohsinn, eine ungemeine Verträglichkeit und grosse Liebe zur Reinlichkeit. Im Erzgebirge wird eifrig gesungen und noch eifriger musicirt; Breitenbrunn und Klostergrab, Kupferberg und Gottesgabe, vor allen aber Pressnitz, senden Schaaren von Musikern hinaus in die Welt. Während es anderwärts oft nicht gut thut, wenn zwei Familien in demselben Hause wohnen, so hausen im Erzgebirge oft drei bis vier Familien in einer Stube, ohne dass man viel von unfriedfertigen Auftritten hört; sicherlich ein Beweis, dass die Bewohner sanft und schmiegsam sind. Der Sinn für Reinlichkeit tritt dem Fremden ungesucht entgegen. Die steinernen Gebäude gefallen meist schon durch ihren gut erhaltenen Bewurf und Anstrich und das Innere der Häuser und Hütten erfreut noch mehr durch die daselbst herrschende Sauberkeit. Die Zimmerwände sind reinlich getüncht, die Dielen weiss gescheuert, die Haus- und Küchengeräthe blank geputzt! Und wenn der Maassstab Liebig's richtig ist, dass man die Kultur von Volksgruppen nach dem von ihnen verbrauchten Quantum Seife beurtheilen könne, so wird den Erzgebirgern eine bevorzugte Stellung einzuräumen sein; denn nirgends wird wohl mehr, als bei ihnen gewaschen und gescheuert. In der That macht auch der geringe Mann im Erzgebirge eher den Eindruck eines verarmten Gebildeten, denn eines armen Natursohnes.
Fragt man den Erzgebirger selbst, was er für die wesentliche Eigenschaft seiner Landsleute halte, so wird man sicher zur Antwort bekommen: »Die Gemüthlichkeit!« Ein vieldeutiges Wort! worunter man aber im Allgemeinen das Streben zu verstehen hat, sich und Anderen das Leben angenehm zu machen. Im Gebirge wird eben aufmerksam beachtet, nicht nur was man sagt und was man thut, sondern auch wie man es sagt und wie man es thut. Gewandte Personen gelten als »manierlich« und erhalten leicht Beifall; eckige Naturen werden mit zweifelhaftem Auge, Störenfriede mit Widerwillen betrachtet. Durch die genannte »Gemüthlichkeit« wird allerdings die Geselligkeit erhöht und ein angenehmer Ton im gegenseitigen Umgang geschaffen, doch auch die Thatkraft und der Trieb zur Selbstverwaltung etwas abgeschwächt.
12. Geschichtliches. – Vor Alters war das Erzgebirge ein grosser zusammenhängender Wald, der Miriquidi genannt wurde. In der Völkerwanderung nahmen die Sorben, ein slavischer Volksstamm, Besitz von dem Lande zwischen Saale und Elbe und siedelten sich auch an dem Fusse des Erzgebirges an. Mit der Gründung der Mark Meissen (928) begannen jedoch die Deutschen, sich als Eroberer in dem genannten Gebiete festzusetzen und Burgwarten und Klöster anzulegen. Dadurch wurden die Sorben genöthigt, bergaufwärts zu rücken und sich in dem unwirthlichen, aber für sie freien Miriquidiwald niederzulassen. Sie gründeten um jene Zeit die Städte Lössnitz, Zwönitz, Zöblitz, Chemnitz, Schlettau, und Zschopau, so wie mehrere darum liegende Dörfer, deren Namen sich auf itz, itzsch, ig, en, und au endigen.5 Noch rascher ging der Anbau des Erzgebirges von statten, als die Silbergänge in der Gegend des heutigen Freiberg fündig wurden (1163). Zahlreiche Bergleute aus dem Harze, aus Franken (aus dem »Reiche«) und Böhmen strömten herbei und legten neben den Gruben verschiedene Flecken und Dörfer an. Freiberg wurde der Mittelpunkt eines regen Bergmannslebens, dessen wohlthätige Wirkungen, zumal man an mehreren Orten Zinn brach, sich auch nach Westen hin verbreiteten. Im obern Erzgebirge entstanden im 12–14. Jahrhundert die Städte Wolkenstein, Elterlein, Schwarzenberg, Aue, Grünhain, Ehrenfriedersdorf, Thum und Geyer. Einen besonderen Aufschwung aber nahm das Gebirge, als man nun 1471 in der Nähe des Kammes zahlreiche Silbergruben erschürfte. Der Abbau wurde eifrigst betrieben; die Ausbeute war gross und so lange der Bergsegen reichlich floss – was bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts geschah – nahm auch die Bevölkerung bedeutend zu. In einem Zeitraum von ungefähr 60 Jahren wurden nicht weniger als 11 neue Bergstädte gegründet, nämlich: Schneeberg 1477, Annaberg 1496, Buchholz 1504, Joachimsthal 1516, Gottesgabe, Eibenstock und Jöhstadt 1517, Marienberg 1521, Scheibenberg 1522, Wiesenthal 1526 und Platten 1532. – Von Einfluss dabei war, dass die Erzgebirger, wie fast alle Bergleute Deutschlands, auf die Seite der Reformation traten und mit Begeisterung die Lehren des kühnen Bergmannsohnes annahmen.