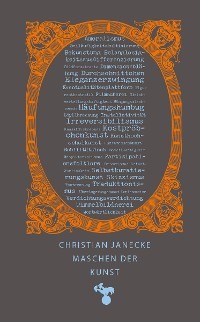Loe raamatut: «Maschen der Kunst»
Christian Janecke
MASCHEN
DER KUNST

Inhalt
Cover
Titel
Einleitung
Amoralismus
Beiläufigkeitskultivierung
Bekunstung
Belanglosigkeitsausdifferenzierung
Bildformatrente
Dimensionsblähung
Durchschnittchen
Eleganzerzwingung
Eventualitätenplattform
Figurentheatralik
Filmhuberei
Gleichverteilungshaftigkeit
Hängungsmischmasch
Häufungshumbug
Idyllbrechung
Installativität
Irreversibilismus
Kausaldiskrepanz
Kostpröbchenkunst
Kunsthochschulkunst
Kunstmessenkunst
Mobilitätslook
Modellhaftigkeit
Neopiktorialismus
Partizipationsfolklore
Privatismus
Selbstähnlichkeit
Selbstkuratierungskunst
Skizzismus
Tontrennung
Traduktionismus
Überlagerungskunst
Umrissmanier
Verdichtungsverdichtung
Wimmelbildnerei
Wortwörtlichkeit
Danksagung
Weitere Bücher
Impressum
Einleitung
Wer von einer ›Masche‹ spricht, meint in der Regel wenig Schmeichelhaftes: ein probates bis abgegriffenes Mittel zu aufwandsarmer Effekterzielung. Typischerweise tauchen Maschen in konkurrenzgeprägtem, großem und traditionsreichem Umfeld auf. Nur dort entsteht Bedarf, nur dort findet sich der Nährboden. Nehmen wir zur Erläuterung das Feld des Liebeswerbens: Nicht anders als das der Kunst ist es konkurrenzgeprägt, unüberschaubar und traditionsreich. Es ist dort geradezu einschlägig von ›Maschen des Anmachens‹ die Rede. Genieren würde sich allerdings nur der just einer solchen Masche Überführte. Hingegen würde derselbe Mensch sich Jahre später – angenommen, sein einstmaliges Drängen sei von Erfolg gekrönt worden – vermutlich ganz ungeniert, ja vielmehr im Gefühl des leisen Triumphes daran zurückerinnern. Der Zweck heiligte hier längst die Mittel. Unverzeihlich würden Maschen indes überall dort, wo die Mittel vom Zweck nicht überrollt und schließlich ersetzt werden. So fühlten wir uns zumindest unbehaglich, mit einem Boot in See zu stechen, dessen Erbauern dubiose ›Maschen des Bootsbaus‹ nachzuweisen wären.
Um nun auf die Kunst zu kommen, so gehört sie zweifellos eher in die letztere Kategorie. Was daran Masche ist, wird jedenfalls nicht besser mit der Zeit. Es geht ja auch nicht um ›Maschen des Künstlers‹, irgendwelche Marotten seines Auftretens, die uns, hätten wir erst einmal ein Werk von ihm erstanden, das uns uneingeschränkt gefiele, wahrscheinlich herzlich egal sein dürften. Vielmehr geht es um Maschen, die in der Kunst bleibenden Niederschlag finden, die ein Werk von Grund auf charakterisieren. Diese Charakterisierung trifft aber nichts Individuelles, sondern etwas Allgemeines, das dieses Werk mit einer unabschließbaren Gruppe weiterer Werke teilt. Womit ein heikler Punkt angesprochen wäre: Denn dadurch gerät, wer von Maschen der Kunst (= M. d. K.) handelt, unversehens in Konflikt nicht allein mit denen, die Unrühmliches von der Kunst fernhalten wollen, sondern auch mit jener Sorte Kunstliebhaber, die in vernebelter Fortsetzung genieästhetischer Annahmen auf der Uneinholbarkeit des einzelnen künstlerischen Ansatzes oder Werkes beharren: Dem individuum ineffabile wird von ihnen kurzerhand noch ein opus ineffabile beigeordnet.
Wer von einer M. d. K. spricht, den ereilt daher schnell der Standardvorwurf gegenüber dem um Generalisierungen und mithin Kategorisierbarkeit und Prinzipien Bemühten: Da sei die Kunst wieder einmal unzulässigerweise in diese oder jene »Schublade« gepackt worden. Doch wie ist es um diesen Vorwurf bestellt? Wer ihn äußert, könnte dahinter nur seine generelle Ablehnung von Kategorien oder Hinsichten verbergen, was man ihm verübeln sollte. Oder er reagiert aversiv tatsächlich nur auf von außen an Kunst herangetragene statt aus ihr abgeleitete Hinsichten. Zeitgenossen, denen also ohne weiteres einleuchtet, dass es gegenüber Pflanzen, aber auch gegenüber Stühlen oder studentischen Klausuren nicht völlig abwegig ist, von außen gewisse Hinsichten oder Kategorisierungen an die betreffenden Dinge heranzutragen, verlangen partout, dass gegenüber der Kunst das Maß stets aus dem zu Messenden zu gewinnen sei. Wer in kunstliebhaberischem Protektionismus diesem Irrtum anhängt, wird aus dem vorliegenden Buch eher Verdruss schöpfen.
Umgekehrt, nun also an die Adresse der von jüngerer Kunst immer schon Entnervten, denen in ihrer Ablehnung zeitgenössischer Spielarten künstlerischer Kreativität jede, auch eine generalisierende, Handhabe willkommen wäre, sei gesagt: Der Buchtitel Maschen der Kunst scheint nach dem Beifall von der falschen Seite zu schielen, indem er Entlarvung verspricht, indem er angriffslustig und vielleicht sogar etwas ressentimentgeladen klingt. Was dieser Titel deckt, ist aber alles andere als kunstfeindlich. Es folgt keiner populistischen Stimmungsmache gegen zeitgenössische Kunst, es nimmt keine Rache an apologetischen Theorien der Kunst. Es wird auch nicht der notorische Einspruch des Etablierten gegenüber dem Ungesicherten erhoben. Künstlerische Originalität und Innovation werden nirgends verhöhnt. Vielmehr dürften sie eher erkennbarer werden. Indem nämlich das an den Werken einer Masche Verhaftete abziehbar wird. Der Kunst schadet es nicht, auf stete Muster, auf bestimmte Kniffe, Tricks und unterschwellige Formeln hin durchforstet zu werden – ein Unterfangen, das so kunstfern nicht sein kann, zumal, wenn es von Künstlern selbst immer wieder einmal in Angriff genommen wird, ich nenne nur: Sigmar Polke, Martin Kippenberger oder heute Christian Jankowski. Mit Wertungen wird ohnehin sparsam verfahren. Der Tonfall ist gelegentlich streitlustig. Doch es überwiegen Neugier und Staunen ob der Verbreitung und Funktionsweisen der hier versammelten und analysierten Maschen.
In älterer Zeit zehrte Kunst bekanntlich weniger von der Neuerung als von Nachahmung, Vervollkommnung und Abwandlung des bereits Erreichten. Erst mit der Neuzeit und Moderne (und nur scheinbar revidiert durch die Postmoderne) wuchsen Originalität und Innovation sich zu derartigen Forderungen, ja Gottheiten aus, dass ihnen nicht zu genügen zum Sakrileg wurde. Einem Künstler zu attestieren, er folge dieser oder jener Masche, kann daher gar nicht generell, nicht überhistorisch, sondern nur modernerweise überhaupt ein Vorwurf werden. Man könnte deshalb seit der Renaissance sogar eine zunehmende gegenseitige Verdächtigung der Künstler hinsichtlich des Profitierens von gewissen Wirkmitteln als regelrechten Gradmesser aufkeimender Modernität begreifen. Die im 18. und 19. Jahrhundert von Kritikern oder Karikaturisten, aber genauso von Künstlern gegenüber ihresgleichen vorgenommene Desavouierung gewisser als unlauter eingestufter künstlerischer Erfolgsprinzipien ist Teil einer Geschichte öffentlicher, agonaler, streitbarer Anteilnahme an der Kunst. Nur befürchte ich, dass sich diese Art von Anteilnahme weitgehend erschöpft hat. Zwar gibt es noch die Kunstkritik. Falls überhaupt, so bestraft sie aber eher durch Nichtbeachtung als durch Verriss. Doch kaum mehr verspotten Künstler ihresgleichen so triftig, dass es über den Künstlerstammtisch hinausreichte. Bedeutungslos wurde der begründete wie auch der idiosynkratische Einspruch gegenüber neuesten Setzungen der Kunst, als wunderlich oder vorgestrig erschiene, wer ihn noch ernsthaft erheben wollte. Und zwar nicht, wie uns ein an Luhmann geschultes Argument Glauben machen will, weil nur mehr kunstintern über Kunst kompetent geurteilt werden könne (und nur Ausgeschlossene ihre Entrüstung kultivieren würden). Sondern weil durch die erhöhte Novitätenfrequenz in Sachen Künstlernamen, Themen, Agenden und Diskurs nicht allein Außenstehenden, sondern mittlerweile auch den allermeisten Angehörigen der Kunstwelt der Lauf der Kunst wie unaufhaltsame Naturgeschichte erscheint: Es wächst und sprießt eben überall. Skepsis gegenüber irgendeiner Neuerung oder Laune der Gegenwartskunst würde in unseren Tagen daher auch nicht mehr, wie noch im vergangenen Jahrhundert, erst nachträglich von einer Jahre späteren Zukunft Lügen gestraft werden, die die Kanonisierung des einst Bekämpften untrüglich offenbart haben würde. Solcher Einspruch erledigt sich heute bereits in Realzeit durch Blitzvergreisung. Noch nicht ausgesprochen, kristallisiert das kritische Wort, wird es hinter sich gelassen von den so unerfindlichen wie unumkehrbaren Emergenzen des Kunstzeitgeistes und seiner pittoresken Niederschläge. Diese Situation begünstigt aufseiten der von Gegenwartskunst noch nicht Kurierten, also bei ziemlich vielen, ein prophylaktisches Mitläufertum gegenüber einem in Börsenkurs-Manier ständig aktualisierten state of the art der Kunst.
Dementsprechend erscheint kaum jemandem die Suche nach charakteristischen Effekten und Maschen lohnenswert. Vielmehr sind es fieberhaft wechselnde Themen und Namen der jüngsten Kunst, denen hinterherzuhecheln dem Einzelnen heute eine ganze Bandbreite Orientierung versprechender Publikationen zur Seite steht. Dieses Spektrum reicht in den letzten Jahren von Ratgeberliteratur für Sammler über Crashkurse zur jüngeren Kunst bis hin zu umfänglichen Anthologien. Dort werden dem Leser die aktuell vermeintlich wichtigsten Künstler nach einem stehenden Muster aus biografischer Notiz und einigen beschreibenden Zeilen nebst Abbildungskonvolut vorgestellt. Nur dass diese Auswahl nach wenigen Jahren ungerührt durch andere Namen und Akzentsetzungen modifiziert oder ersetzt wird. Man hält dann zwar mächtige Schwarten in Händen, fühlt sich aber dennoch irgendwie an das kurzlebigere Format eines Rankings erinnert.
Nicht anders bei Postillen oder smarten Magazinen zur Kunst. Man wird den Eindruck nicht los, dass jene Unüberblickbarkeit und Kriterienlosigkeit, die zu kompensieren Verleger und Autoren solcher Publikationen angetreten waren, durch Letztere selbst geschürt werden. Denn hier werden à la mode sämtliche Positionen und Topoi von oben nach unten durchgereicht, was die Produktobsoleszenzen nur weiter ankurbelt. Man konsultiert solche Medien daher mit einer aasigen Mischung aus Widerwillen und Neugier. Man möchte also schon gerne wissen, wen das Orakel diesmal drin sieht und wen nicht, obwohl einem doch klar ist, dass bestenfalls hauchdünne Begründungen oder einfach nur der Tagesgeschmack den Ausschlag gaben.
Bereits der Durchblicker-Tonfall des Buchtitels von Jörg Heisers Studie Plötzlich diese Übersicht. Was gute zeitgenössische Kunst ausmacht (2007) signalisiert, dass auch hier uns jemand helfend beispringen will im Dschungel der Gegenwartskunst (und dies übrigens in nachdenkenswerter Gruppierung, temperamentvoll, geistreich und lesbar unternimmt). Nur bleibt auch das eine Geschichte der Sieger und ihrer Siege. Wer darin vorkommt, der hat es geschafft, der hat mit seiner künstlerischen Manier Unverwechselbarkeit erreicht. Und das gilt natürlich auch noch für die Künstler, an denen der Autor kluge Kritik übt.
Vergleichbar steht es um all jene Protagonisten des künstlerischen Feldes, über die nicht nur in entlegenen Monographien und Katalogen auftragshalber geschrieben wird, sondern über die man einer großen Leserschaft wiederholt Bericht erstattet. Daran ändert sich auch wenig, wenn man auf ambitionierte und theoriestarke Kunstzeitschriften blickt. Denn die vergleichsweise großen und sozusagen in der Luft liegenden Fragestellungen, denen man dort mitunter in Themenheften nachgeht, versammeln einmal mehr vertraute Positionen. Ausgerechnet aber solchen mit Texten und Erwähnungen verwöhnten Stars und Etablierten eine Masche nachzuweisen, müsste zwangsläufig beckmesserisch wirken. Oftmals handelt es sich ja um etwas seitens solcher Künstler originär Erarbeitetes! Es herauszupräparieren und als Trophäe durch seine Argumentation zu schwingen, wäre keine Ruhmestat.
Und so wird der Blick für Maschen, sogar für die offensichtlichsten Maschen, nur allzu oft verstellt durch eine Melange aus Respekt, Seilschaft, Vorsicht, Desinteresse, Müßigkeit.
Eine Erfassung von M. d. K. verlangt daher zuerst einen Perspektivwechsel: Man schaue auch auf das, was bei Messen nicht unbedingt hervorsticht, sondern die Kojen füllt, was im Ausstellungskalender einer Metropole nicht zu den Highlights, sondern zum Durchwachsenen gehört! Man vergegenwärtige sich das gediegen Mittelmäßige wie auch das Unausgegorene, die Usancen des ambitionierten Nachwuchses wie auch manche Nachhutgefechte! Man lasse all das zu, was einem als professionell mit Kunst Befassten ohnehin dauernd unterkommt, auf das man sonst aber keinen Ehrgeiz verschwendet!
Unter diesen Voraussetzungen sind es wiederkehrende Maschen, die sich dem über Kunst Nachdenkenden geradezu aufdrängen. Maschen, die der heutigen Produktion von Kunst, teils auch schon ihrer Konsumtion und Kommunikation zugrunde liegen. Maschen, die uns vertraut oder ungewöhnlich vorkommen, die kaum je explizit erwähnt werden, obgleich uns unser Umgangswissen mit Kunst sagt, dass wir schon unzählige Male darauf gestoßen sind.
Nur wäre es eitler Irrtum, zu glauben, solche Phänomene gehörten gar nicht in den Spitzen-, sondern nur in den erwähnten Breitensport der Kunst, bloß weil sie dort besser sicht- und greifbar wurden! Denn an der Basis erhalten sich solche M. d. K. nur ungenierter und häufiger in Reinkultur. Hat man sie dort aber erst einmal benannt und analytisch auf den Punkt gebracht, so wird man sie unschwer auch in den höheren Etagen des Kunstbetriebs wiederfinden. Nur dass es dort oft peinlichkeitsvermeidende Mischungen mehrerer und mithin Abtrübungen einzelner Maschen sind, die dem Künstler helfen, sich die Gunst eines für Abgegriffenheiten sensibilisierten Publikums zu erhalten.
Wie man sich denken kann, entsprechen etlichen M. d. K. gewisse Legitimationsmuster aufseiten der Kunstkritik oder der Kunstgeschichtsschreibung. Das könnte uns zu der Überlegung verleiten, ob nicht, statt die Verantwortung allein bei den Künstlern bzw. der Kunst zu suchen, mit eben so viel oder mehr Recht von Maschen der Kunstgeschichte bzw. der Kunstkritik auszugehen wäre. Beispielsweise dürfte einem künstlerischen ›Häufungshumbug‹ der verbale Häufungshumbug aufseiten manch sprachschäumender Katalogautoren in nichts nachstehen. (Denn man könnte spekulieren, ob nicht beides Indiz der nämlichen Selbstverschlagwortung von Sinnproduzenten im Zeitalter internetbasierter Aufmerksamkeitsökonomie geworden sei.) Doch führen die meisten Kapriolen der Kunst, so sie von der Kritik nicht ohnehin ignoriert werden, die Kapriolen der zugehörigen Kunstliteratur nur im Gefolge. Deswegen bleibt mein Hauptinteresse bei den Maschen in der Kunst selbst, erst in zweiter Linie gilt es ihrer Verzahnung mit gesprochenen wie geschriebenen Worten zur Kunst. Dass es ungeachtet dessen auch originäre Maschen der Kunstkritik bzw. der Kunstgeschichtsschreibung gibt, die nun wirklich zuallererst auf das Konto der schreibenden Zunft gehen, sei damit keineswegs bestritten. Nur sind solch eingefahrene Muster des Ausdeutens oder Belobigens von Kunst doch ein anderes Thema, dem sich Autoren wie Beat Wyss oder Christian Demand auf anregende Weise widmen.
An einem Vorverständnis dessen, was eine M. d. K. ungefähr sein könnte, ließen es die meisten der Fragen und Anregungen, mit denen ich im Vorfeld konfrontiert wurde, nicht mangeln. Eher haperte es an einer Vorstellung davon, wie viel eine Masche sinnvollerweise jeweils sollte fassen können.
Zum einen bezogen sich etliche Ratschläge auf etwas tendenziell viel zu Kleines, das ich der Einfachheit halber als ›Individualmaschen‹ bezeichnen würde: Kopfüberstellungen figürlicher Motive bei Baselitz, Günther Ueckers Eigenart, mit Nägeln zu arbeiten, Thomas Hirschhorns Faible für Paketklebeband, Jonathan Meeses Teutonen-Eintopf usw. Vermutlich gibt es so viele Individualmaschen, wie es profilierte Künstler gibt. Nur enthalten sie kaum Prinzipielles – was sollte schon das ›Prinzipielle‹ einer unablässigen Verwendung von Nägeln sein? Vor allem aber sind Individualmaschen für Nachahmer nur mäßig attraktiv. Je markanter und nachahmenswerter nämlich das Nachgeahmte ist, desto wahrscheinlicher wird der Nachahmende als Epigone gelten.
Zum anderen erhielt ich Tipps, die auf etwas viel zu Großes, ja auf Allerweltsaspekte zielten. Ich würde hier behelfsweise von ›Megamaschen‹ sprechen. In diese Gruppe flächendeckender künstlerischer Geschmacksverstärker gehört beispielsweise ›sex sells‹ oder auch jene omnipräsente Rückgriffsmentalität, die im Präfix ›Retro‹ Ausdruck findet. Auf einen erheblichen Anteil jüngerer Kunst träfe gewiss das eine oder das andere (oder auch beides) zu. Nur wäre mit solchen Megamaschen nichts wirklich Spezifisches oder Treffliches über die persuasio eines Werkes ausgesagt, über die Art, wie es uns als Betrachter um den Finger wickeln will.
Die M. d. K., um die es im vorliegenden Buch gehen wird, sind daher weder von so grober Art, dass die Bestimmung ihrer Implikationen trivial bis müßig würde, noch derart punktuell, dass ihnen alles Prinzipielle abginge und Nachahmer kompromittiert dastünden.
Mit meinem Buchvorhaben konfrontiert und wohl mit Blick auf sein eigenes Werk, fragte mich ein erfahrener Künstler etwas gereizt, ob denn die Spezialisierung auf ein bestimmtes Material in der Kunst auch schon einer ›Masche‹ gleichkomme. Und Kollegen von der Kunstgeschichte wollten wissen, wie es um den Einbezug allgemein bekannter Symbole oder die Verwendung bereits fest eingeführter Zeichen stehe. Ob bereits die Entscheidung eines Malers für ein bildtypisches Format eine Masche impliziere, weil damit konventionalisierte Wirkungen übernommen würden, usw. Was in all diesen Fällen nottat, war eine Abgrenzung gegenüber Konzepten und Kategorien, die man zur begrifflichen Nachbarschaft von M. d. K. zählen kann. Zwar hoffe ich, dass die Lektüre dieses Buches und seiner zahlreichen Einträge es jedermann unmissverständlich klarmachen wird, was als M. d. K. gelten darf und was nicht. Dennoch will ich entsprechende Hinweise geben. Da ein Vorverständnis bereits erreicht ist, kann ich mich auf die jeweils zu skizzierende differentia specifica beschränken.
Die erste und leichteste Unterscheidung, die es zu treffen gilt, ist die zwischen einer Masche und einem Mittel. Beispielsweise mag sich ein Künstler des ›Mittels‹ der Zentralperspektive bedienen. Wären aber M. d. K. tatsächlich nichts anderes als derart grundlegende, so diverse wie legitime ›Mittel‹ des Kunstschaffens, so müsste ihr Nachweis völlig trivial erscheinen. Und auf solche Maschen (alias Mittel) zu verzichten, könnte den Künstlern wirklich nur ein Narr abverlangen.
Lohnender erscheint die Unterscheidung zwischen einer Masche und dem, was man als ›Voreinstellung‹ oder in der Sprache der elektronischen Musik und der Popdiskurse als ›Preset‹ bezeichnet hat. Durch den Einsatz mehrerer solcher Presets vermag ein Musiker heute im Handumdrehen passable Rhythmen oder klangliche Effekte zu erzielen, ohne dass er über größeres handwerkliches oder musikalisches Können verfügen müsste. Was läge näher, als hier wenigstens eine Verwandtschaft zur Masche zu mutmaßen? Doch machen Presets aus ihrem Einsatz gar kein Geheimnis. Oftmals handelt es sich um nichts weniger als unhintergehbare Grundelemente oder Vorgaben eines Mediums, mit denen umzugehen gerade den Reiz ausmachen kann, betreffe es nun LEGO-Steine oder die fixierten Minimalintervalle eines Tasteninstrumentes. Zu Presets könnte man aber auch Module rechnen, die ein Architekt vielleicht frei gewählt hat, denen er sich in der Folge aber selbst unterwirft. Und natürlich operieren unzählige Symbole, Zeichen sowie andere konventionalisierte Modi, die ein Künstler verwenden kann, als Presets in dem Sinne, dass damit bereits kodifizierte Bedeutung in ein Werk übernommen werden kann, also vorverpackte Sinneinheiten, die ein Künstler nicht neu erfinden muss. Würde, um es an einem Beispiel zu verdeutlichen, ein Künstler Horribles in märchenhaftem Gewande darbieten und sich dazu gewisser Rotkäppchen-Stereotypen bedienen, so hätten wir es wahrscheinlich mit alles andere als verwerflichen, nämlich der Wiedererkennbarkeit halber durchaus angebrachten ›Presets‹ zu tun. Dem Künstler indes zu bescheinigen, insgesamt verfolge er eine nicht sonderlich originelle Strategie der ›Idyllbrechung‹– das hieße bereits, über eine ›Masche‹ zu diskutieren.
Was findet sich sonst noch in der begrifflichen Nachbarschaft? Hier überlappt sich manches, und es ist zum Teil ein Streit um Worte. Was nichts anderes heißt, als dass es beim Begriff der ›Masche‹ kaum um völlige, sondern nur um größtmögliche Angemessenheit gehen kann. Denn da gibt es beispielsweise auch noch das ›Prinzip‹ und das ›Muster‹– Begriffe, auf die ich mitunter verfalle, wo sie besser passen oder ausreichen. Mit beiden teilt die Masche das den Einzelfall übersteigend Verallgemeinerbare. Vom Prinzip unterscheidet sie sich allerdings dadurch, dass sie weder als leitender Wert, etwa als Maxime, noch auch als Formel taugt (wir können uns ein Prinzip der Schwerkraft, aber keine Masche der Schwerkraft vorstellen!). Und im Unterschied zum starren Muster denken wir uns die Masche doch geschmeidiger, schließt sie Funktionen nicht aus. Blieben noch der Kniff, der Trick oder das Manöver, mit denen die Masche zwar das nötigenfalls Unredliche teilt, insbesondere das günstige Verhältnis von geringem Aufwand und passabler Wirkung. Nur ist die Masche eben nichts Singuläres oder Situationsgebundenes, und eigentlich ist sie selten von gewitztem Vorsatz geprägt.
Aus dieser insgesamt verzwickten Zwischenstellung wird, so hoffe ich, etwas plausibler, warum ich am flapsigen Begriff der ›Masche‹ festhalte. Zumal damit auch eine gewisse Offenheit gewahrt ist, was den Grad an vorauszusetzender Absichtlichkeit betrifft: Eine Masche zu diagnostizieren, impliziert nicht ohne weiteres, ihr Urheber frohlocke insgeheim darüber, uns Betrachter wieder einmal an der Nase herumgeführt zu haben. Er könnte von besagter Masche auch profitieren, ohne sie vorsätzlich in Anschlag gebracht zu haben. Mit anderen Worten: Manche Maschen trägt der Künstler vor sich her oder mit sich herum – andere Maschen tragen den Künstler vor sich her oder mit sich herum!
Darbietungsgestus und Artikelabfolge dieses Buches geben sich lexikalisch, obwohl ich vermute, dass kein Leser das für bare Münze nehmen wird. Zwar gefällt mir der mit einem Lexikon altmodischer und wohl auch sentimentaler Weise immer noch verbundene Anspruch gültigen und bündig vermittelten Wissens. Doch in Wahrheit hat mich eher die alphabetische und mithin sachlich völlig zufällige Abfolge der Artikel interessiert, die bei einem wirklichen Lexikon natürlich nur eine der Auffindbarkeit der Artikel geschuldete Inkaufnahme darstellen würde. In meinem Falle drückt sie eher Misstrauen gegenüber der Möglichkeit großsystematischer Kritik und Erfassung von Problemen gegenwärtiger Kunst aus. Die ziemlich unterschiedlichen Aspekte, die ich in meinem Buch glaubte unterbringen zu müssen, hätten durch eine Aufteilung in Kapitel und Abschnitte, zumal in ein unentrinnbares Vorne und Hinten im Buch, gar nichts gewonnen. Und dass die einzelnen Abhandlungen tatsächlich verlustfrei in beliebiger Folge gelesen werden können, war mir willkommen als leiser Anklang an das zuweilen gehäufte oder vermischte Auftreten entsprechender Maschen in der jüngeren Kunst selbst.
Das heißt aber nicht, dass die Leser es bloß mit der lexikalischen Ummäntelung eines Patchworks versprengter Gedankensplitter zu tun bekämen. Nicht nur unternimmt jeder Artikel für sich durchaus systematische, wo nötig auch historische Aufschlüsselung. Die Lektüre wird über die vielen Einträge hinweg auch unweigerlich Zusammenhänge offenbaren, nämlich durch wiederkehrende Probleme, die unter veränderter Perspektive erneut aufgegriffen werden. Dementsprechend auftauchende Querverweise sind dann jedenfalls mehr als eine bloße Marotte des Lexikalischen.
Vergleichbares gilt für die Anzahl der Artikel: Wahrscheinlich gibt es bzw. könnte es noch wesentlich mehr Maschen geben (obwohl für mich als Autor irgendwann der Punkt erreicht war, ab dem weitere sich aufdrängende, vermeintlich noch unentdeckte Maschen immer unabweisbarer in thematische Überschneidung traten mit den bereits vorhandenen). Doch so wie ein Lexikon sein Wissensgebiet mit Artikeln in eher gleichförmiger Verteilung zu überziehen sucht, geschah es auch hier mit den M. d. K. Eine denkbare Fortsetzung würde diese Verteilung daher nicht ohne weiteres besser, sondern nur dichter machen – wogegen ich aber nichts einzuwenden hätte.
Schließlich ist mir bewusst, dass viele, wahrscheinlich sogar jede einzelne, der hier aufgeführten Maschen eine wesentlich ausgiebigere Darlegung verdient oder verlangt hätten, als es die spärliche Anzahl Seiten, die dafür jeweils reserviert ist, zulässt. Doch obgleich ich sogar selbst schon einige Maschen im Visier habe für spätere Aufsätze oder etwaige Buchprojekte, wollte ich die Texte für dieses Mal um jeden Preis kurz halten. Warum? Weil im Kunstbereich massenhaft und großteils immer schlechter Geschriebenes publiziert wird, das kaum mehr jemand lesen will oder kann. Weil zugleich das Internet immer umfangreichere und genauere Informationen und Kommunikationsforen zu ganz speziellen, sogar entlegensten Aspekten der Kunst bietet. Weil, so man beides zusammen nimmt, ziemlich klar sein dürfte, dass es immer besserer Gründe bedarf, um heutige Kunst(theorie)interessierte überhaupt noch zur Lektüre eines entsprechenden Buches zu bewegen, sie dazu zu bringen, ihre immer kostbarer werdende, da von immer mehr Akteuren und Angeboten umworbene Lesezeit zu investieren. Ich wollte auf diese Situation weder mit ungebührlicher Vereinfachung noch elitär, also mit randvollen Textmonolithen reagieren, deren ausufernde Überlegungen und Einlassungen nur von mir selbst für unentbehrlich gehalten würden. Daher kommen die drei Dutzend Artikel meist ohne Umschweife zur Sache und liefern Gedanken ohne Vestibül, aber mit Hinterausgängen.