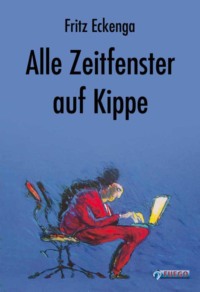Loe raamatut: «Alle Zeitfenster auf Kippe»
Fritz Eckenga
Alle Zeitfenster auf Kipp
Geschichten und Gedichte aus der angewandten Wirklichkeit
FUEGO
Über dieses Buch
Fritz Eckenga lässt sein Fenster geöffnet. Durchzug sorgt für frische Luft. Der Zeitgeist? Eine vorübergehende Erscheinung. Er hat keine Chance, zu lange durch die Bude zu spuken. Wenn er lästig fällt, fliegt er raus. Genauso wie die elektrischen Geräte, die die vorgeblich große Welt in die vier Wände übertragen. Ausschalten ist eine Möglichkeit. Das offene Fenster bietet eine Alternative.
Eckenga lässt die Experten, die den Mittelschlichten immer die ganz komplizierten Sachen erklären, nicht zu nah an sich heran. Lieber macht er eigene Spazier- und Gedankengänge, beschreibt und bedichtet die Welt, wie sie sich ihm zur Verfügung oder in den Weg stellt.
Seine Geschichten schlendern über Westfälische Wochenmärkte, auf denen elegant frisierte Damen den Champignons auch nur vor die Köpfe schauen können. Sie klettern auf Tessiner Almwiesen, wo aus übel riechenden Ziegen duftende Lebensmittel extrahiert werden. Sie machen Rast in Parkanlagen, in denen hochbegabte Gören ihren dummen Müttern erläutern, warum Flamingos erst nach brutaler Beinamputation und anschließender Blutwäsche rosa werden.
Bei der Lektüre von Fritz Eckengas neuem Geschichten- und Gedichteband erfährt der Leser, was ein sterbender Opel-Kadett und ein erstickender Tintenfisch gemein haben, wie man in vier Gedichtzeilen die Deutsche Integrationsdebatte über den Haufen reimt und wann der Dativ im Ruhrgebiet kein Ausnahmefall ist. Da der Autor in der Deutschen Meisterstadt zuhause ist, gibt er kernkompetent Auskunft darüber, dass man bei der Farbkombination Schwarzgelb nicht Schauriges wie »Bundesregierung«, sondern Schönes wie »Borussia« assoziieren darf.
Für die Bottroper Botschaften
Von der Größe der Dinge
Schon sehr früh in meinem Leben, im Alter von vier Jahren, habe ich mich dazu entschlossen, kein Tagebuch zu führen. Ich will nicht verheimlichen, dass die Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt dem Umstand geschuldet war, dass ich noch gar nicht schreiben konnte. Doch auch nach Erlernen der Technik habe ich den Entschluss nie bereut. Die wenigen, wirklich wichtigen Erlebnisse brennen sich einem ohnehin fotografisch ins Gedächtnis ein. Will ich mich an sie erinnern, muss ich nur das betriebsinterne Bilderalbum durchblättern. Eine Beschäftigung, die manchmal zeit- und nervenraubend, oft vergeblich, aber bestimmt nicht mühseliger ist, als aus etlichen Metern schwedischer Pressspanregale verstaubte Jahrgangskladden zu klauben, in denen man das eigene Leben katalogisiert und vertagebucht hat. Außerdem bietet einem das nachträgliche schriftliche Niederlegen des Erlebten die vielfältigeren Möglichkeiten. Je größer die Distanz zum Ereignis, desto wichtiger der Einsatz von Phantasie. Je vergilbter die Fotos, je klaffender die Gedächtnislücken, desto zwingender die Notwendigkeit, sich gefälligst etwas aus- und dazuzudenken. Schon Aristoteles wusste: »Gegenstand der Erinnerung ist eigentlich alles, wovon man sich ein Phantasiebild machen kann.«
Ich war vier Jahre alt und fast alle Dinge um mich herum hatten riesige Dimensionen. Der Sessel, in dem ich sitzen musste, war viel zu groß. Oben an der Rückenlehne war eine Nackenstütze angebracht. Erst, als ich ein paar Kissen unter dem Hintern hatte, kam ich mit dem Kopf hoch genug. Frisöre hatten solche Sessel. Man konnte sie mit einer Fußpumpe höher stellen, damit der Haareschneider sich bei seiner Arbeit nicht soweit runterbeugen musste.
Ich wusste nicht, dass man sich beim Krankenhaus-Doktor auch in diese riesigen Dinger setzen muss. »Die Schwester tut dir jetzt einen Latz um«, brummte der Kinderschreck. So hatten meine Eltern den Arzt mal genannt, als sie leise darüber redeten, dass ich bald ins Krankenhaus muss, damit er mir da die entzündeten Mandeln rausoperiert. Sie dachten, ich bekäme das nicht mit. Ich hatte das aber mitbekommen und seitdem hatte ich Angst vor dem Kinderschreck. Jetzt stellte sich raus, dass sie sehr berechtigt war.
Der große weiße Mann hatte Hände wie Bratpfannen. Sie steckten in Plastikhandschuhen und hielten zwei Metallgriffe, an denen eine Schlinge befestigt war. Kinderschreck trat einen Schritt zurück, während seine Gehilfin mir den Umhang umband. Die dicke Frau, die Schreck »Schwester« genannt hatte, war als katholischer Riesenpinguin verkleidet. Bodenlanger, schwarzer Umhang, darüber eine Schürze, Kopfhaube mit weißer Halsbandage, daran baumelte ein goldenes Kruzifix an einer Kette. Das Pinguinmonster roch, als würde es in einem feuchten Kleiderschrank gehalten. Nur, wenn es seinen blutrünstigen Besitzer danach gelüstete, eitrige Mandeln aus Kinderhälsen rauszuschneiden, bekam es Auslauf. Dann durfte es den muffigen Monsterschrank verlassen, dem kleinen Opfer ein paar Kissen unter den Hintern schieben, ein riesiges Laken umbinden und mit grabeskalter Stimme den einzigen Satz sagen, den man ihm beigebracht hatte: »Schön still sitzen, das tut gleich nicht weh!«
Selbstverständlich hatte Pinguin gelogen. Selbstverständlich tat es ganz scheußlich weh, denn im Interesse dieser Geschichte wurden solche Operationen zu jener Zeit selbstverständlich ohne jegliche Betäubung durchgeführt. »Ahhh sagen!«, schnauzte Kinderschreck, steckte mir die Schlinge in den Hals und riss an den Griffen. Ich wollte brüllen, konnte aber nur würgen. Ich würgte, er riss, ich würgte, er riss. Dabei rückte er mit seiner vom Mundschutz halb verhüllten Bluthochdruckvisage immer näher an seinen Operationskrater heran. Er riss, ich würgte, ich würgte, er riss und nach ewig langem Reißenundwürgen spie ich ihm mit Gebrüll endlich einen großen Batzen klumpig Rotes auf Mundschutz und Kittel. Kinderschreck entsprach jetzt endgültig auch äußerlich seinem Namen. In diesem Aufzug hätte er bei jeder ernstzunehmenden Geisterbahn eine Lebensstellung antreten dürfen. Danach stand dem Überqualifizierten aber offenbar nicht der Sinn. Angewidert machte er einen Satz rückwärts und schrie ein nur wenig durch den Mundschutz gedämpftes »Scheiße!« in Richtung Pinguin.
Hier werden meine farbigen Erinnerungen plötzlich undeutlich. Vergilbte Schwarzweiß-Fragmente mit gezacktem Rand, sich langsam auflösende Schemen. Dann reißen sie ganz ab. Bestimmt fiel ich in einen langen, tiefen und traumlosen Schlaf oder etwas vergleichbar schundromanartiges.
Als ich wieder aufwachte, waren die Schmerzen verschwunden. Dem Himmel sei Dank, denn in Dortmund war soeben die Bundesgartenschau, der spätere Westfalenpark eröffnet worden. Ich hatte mich gerade dazu entschlossen, niemals in meinem Leben Tagebuch zu führen. Die Niederschrift der Geschichte über die brutale Mandelentfernung musste also noch warten, bis sie wirklich reif war. Das würde ihr guttun. Außerdem war es viel vernünftiger, die aufregende Zeit zu nutzen, um Grundlagen für neue Erinnerungen zu schaffen.
Ich war vier Jahre alt und und fast alle Dinge um mich herum hatten riesige Dimensionen. Der Sessel, in dem ich saß, war viel zu groß für mich. Ein Sicherheitsbügel sorgte dafür, dass ich nicht vorne heraus- und hinunterfallen konnte. Der Sessel hing an einem langen Anker, an dessen oberen Ende ein großes Rad befestigt war. Das Rad lief über ein dickes Stahlseil. Das Seil war hoch und weit über den Park gespannt. Wahrscheinlich hundert Meter hoch und zehn Kilometer weit. Die Erwachsenen verboten einem, rumzuzappeln. »Zappel nicht rum, sonst kippsse da raus und dann fliegsse runter und dann bleibt nur noch ’n Fettfleck von dir übrig!« Man musste also schon verdammt mutig sein, wenn man da einstieg. Die riesige Sesselbahn war eine der gewaltigen Attraktionen der Bundesgartenschau 1959. Sowas hatte die Welt, soweit sie in Dortmund wohnte, vier Jahre alt und drei Käse hoch war, noch nicht gesehen. Nach zwei Dutzend Fahrten hatte die Bahn ihren größten Schrecken, nicht aber ihre Faszination verloren. Von da oben genoss der mutige Weltbewohner einen weiten Blick über hollandgroße Tulpenfelder mit zig-Millionen, streng nach Farben geordneten Blüten: eine Million rote, eine Million gelbe, eine Million weiße und so weiter, solange eben, bis es zig-Millionen waren; auf den Turm, den Fernsehturm »Florian«, 1959 war er das größte Gebäude Deutschlands; über rasierte Rasenflächen, mehr als alle Aschenplatzfußballfelder der Stadt zusammen; über weite, sanft zu einem See abfallende Hänge. Aus dem See, den die Erwachsenen Teich nannten, schossen einmal in der Stunde riesige Wasserfontänen, die größer und kleiner wurden, je nachdem, wie die Musik spielte. Das nannten sie Wasserorgel.
Es gab noch einen anderen, auch sehr großen, vor allem aber gefährlicheren, weil sehr tiefen Teich, den Robinson-Teich. Darauf durften die Mutigsten mit Schwimmtonnen fahren. Große Schwimmtonnen, in denen sehr viele Mutige stehen konnten. Die Tonnen bewegten sich fort, wenn die Kräftigsten unter den Mutigen mit sehr langen und sehr schweren Holzbohlen in den tiefen, schlammigen Grund des Teiches stießen, in dem gefährliche Ungeheuer, wahrscheinlich Verwandte von Monsterpinguinen, ihr Unwesen trieben. Die Schwimmtonnenschlachten waren wilde Abenteuer, zumal man ständig gegen die anderen Tonnen-Fahrer bestehen musste, die einen rammen wollten. Viele von uns hätten damals eigentlich verbluten, noch viel mehr ertrinken müssen. Die meisten haben überlebt – ich weiß bis heute nicht, warum.
Ich bin mehr als fünzig Jahre älter und nicht wenige Dinge um mich herum sind nach und nach kleiner geworden. Robinson-Teiche, Sessellifte und Blumenfelder haben im Laufe der Zeit sogar einen erheblichen Schrumpfungsprozess durchgemacht.
Einige Dinge jedoch haben wunderbarer Weise nichts, aber auch gar nichts von ihrer Größe verloren. Dazu zählt der Florianturm im Westfalenpark, sowie ausnahmslos alle Arbeitsgeräte von Hals-Nasen-Ohren-Ärzten.
Ach ja – und das sollte nicht unerwähnt bleiben. Eins gibt es, das wird, je älter ich werde und je entschlossener ich kein Tagebuch schreibe, eins gibt es, das wird sogar immer noch größer: Mein phänomenales Erinnerungsvermögen.
Der Sommer der Kuh
Ostenhausen. Manchmal legt Silke nachmittags ihre alte Lieblingsscheibe auf und tanzt sich zurück in den Sommer von 1973. Es war der Sommer der Kuh. Silke und die anderen aus der Ostenhausener Klicke waren an einem Wochenende im Juni nach Dortmund gefahren. Jürgen hatte auf dem Flohmarkt für unglaubliche sechs Mark ein guterhaltenes Exemplar von Atom Heart Mother gekauft. Von dem Tag an trafen sich die beiden, so oft es nur ging. Am besten war es bei ihm, denn Jürgen hatte eine eigene Wohnung und eine super Anlage. Atom Heart Mother war der Soundtrack ihrer Sommerliebe. Schon beim ersten Stück musste Silke immer aufpassen, dass der Rausch sie nicht völlig überwältigte. Es dauert ja sagenhafte 20 Minuten.
Im Oktober 73 zog Jürgen zum Studieren nach Kassel und schenkte Silke zum Abschied das Album. Zwei Jahre später heiratete sie Wilfried.
Das unten anhängende Gewächs
Ein paar Bemerkungen anlässlich des Valentinstages
Jedes Jahr am 14. Februar ist Valentinstag. Viele von uns erfahren davon immer kurz vorher aus den Verbrauchernachrichten und treffen sich dann nachts in der Tankstelle ihres Vertrauens. Dort gibt es auch zur Geisterstunde noch alles, was man braucht, um die Herzensangelegenheit geschmeidig abzuwickeln. Zum Beispiel Überraschungseier. Nun aber zum Hintergrund.
Es gibt unzählige Mythen, die sich um den Ursprung dieses Tags der Liebenden ranken. Viele, die meisten, haben einen sogenannten »religiösen« Hintergrund. In ihnen ist von der Ankunft des himmlischen Bräutigams Jesus die Rede. Oder von Bischof Valentin von Terni, der im 3. Jahrhundert lebte und als christlicher Märtyrer starb. Mit allen unangenehmen und bis heute unappetitlichen Folgen. Zahlreiche Skelette des Bischofs klappern um die Wette. Viele europäische Kirchengemeinden streiten sich darum, welche denn nun die Reliquien, also die Originalknochen des italienischen Liebestagsstifters besitzt. Andere Legenden gehen noch den einen kleinen logischen Schritt weiter, also vom Spirituellen zum Spirituösen. Manche Liebenden, so steht es geschrieben, hätten den berauschten Zustand der hormonellen Unordnung mutwillig mit hochprozentigem Treibstoff angefeuert, vulgo: Sich diese oder jenen schlicht und ergreifend schöngesoffen.
In Wahrheit ist es selbstverständlich so, dass der V-Tag den allermeisten Menschen ungeheuer viel bedeutet. Den Frischverliebten, den Gutabgehangenverliebten, den Schon- und Baldvermählten, den Nochnichtgeschiedenen, vor allem aber natürlich den Parfüm- und Blumenhändlern, die die Deutschland-Verwertungsrechte an diesem Feiertag in den fünfziger Jahren vom Lizenzinhaber gekauft haben. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Mischkonzern. Er verschachert unter anderem Olivenöl, intelligente Waffensysteme, Tomatenketchup, Doktortitel, Solarstromanlagen und arabische Diktatoren. Außerdem vergibt er Lizenzen für Feiertagsmarken wie Halloween, internationaler Frauentag, Tag des Waschlappens und eben auch Valentinstag.
Zum artgerechten Umgang unter Liebespaaren gehört ja vor allem die richtige Ansprache. Er nennt sie zärtlich »Kätzchen«, sie entgegnet mit einem angemessenen »Hase«. Das sind natürlich nur willkürlich aus dem Bussi-Brehm herausgepickte Beispiele. Der erotozoologischen Phantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt, wobei schon auffällig ist, dass die beliebtesten tierischen Koseformen mindestens niedlichen, etwa »Mäuschen«, meistens aber flauschigen Ursprungs sind. »Chinesischer Nackthund« zum Beispiel kommt meines Wissens so gut wie nie vor. Selten hört man auch von Liebenden, die sich gegenseitig »Glatthaardackel« nennen. Besser, die Süßen haben ein Fell, noch besser, einen Pelz. »Bär« ist ganz groß im Rennen, »Bärchen« noch beliebter, wobei die Anwender ja keine Ahnung haben, wie schlimm die Viecher aus dem Hals riechen. Ungefähr so übel wie der Heringsfresser Pinguin, was dessen allgemeiner Beliebtheit aber keinen Abbruch tut.
Wenn es einen erwischt hat, hat es einen erwischt. Da kann man nichts machen. Da wird was mit einem gemacht. So, als würde man ferngesteuert. Wieso sind wir manchmal so besinnungslos verknallt? Woher kommt das? Das kommt von der Libido. Libido ist lateinisch und bedeutet »Begehren, Begierde, Wollust«. Mit der Libido verhält es sich, was ihren Wohnsitz angeht, ungefähr so wie mit der Seele. Man weiß, man hat eine, man weiß aber nicht, wo man sie hat. Was man weiß, ist, von wem die Libido mit Kraftstoff betankt wird: Vom »unten anhängenden Gewächs«. Nein, das ist jetzt nicht das, was Sie denken. Sie denken zu niedrig. Das unten anhängende Gewächs hängt zwar unten, aber nicht unten unter dem Gürtel, sondern unten im Gehirn. Damit es nicht dauernd mit etwas Vulgärem verwechselt wird, lässt sich das unten anhängende Gewächs viel lieber mit seinem lateinischen Namen ansprechen: Hypophyse. Und wenn schon auf deutsch, dann so: Hirnanhangdrüse. Wenn die Hypophyse unter Volllast arbeitet, drüst sie wie nichts Gutes und flutet die labile Libido mit einem nicht endenwollenden Hormonstrom, einem wahren Sekret-Tsunami. Da sich der ganze Vorgang im Gehirn abspielt, wird der dort ebenfalls ansässige Verstand vorübergehend außer Kraft gesetzt. In dieser bio-chemisch verursachten Denkpause ist der Mensch dann in der Lage, Sätze zu sagen, zu denen er sonst nicht fähig ist. Zum Beispiel: »Ich kann ohne dich nicht leben.« Irgendwann aber zieht sich die Flut zurück. Der gewöhnliche Verstand erhebt sich nach und nach aus den moddrigen Feuchtgebieten. Es ist Ebbe. Und dann ist manchmal gar keiner mehr da, mit dem man durch das Watt waten kann.
Der schönste Platz ist immer an der Theke
Werner (W) und Bernd (B)
W: Prost.
B: Prost.
W: Was macht die Frau?
B: Die will unbedingt mal weg. Sie sagt, sie braucht mal Tapetenwechsel.
W: Tja, alle wollen immer weg. Und wenn sie dann weg waren, dann kommen sie wieder und sagen, zuhause wär’s am schönsten.
B: Das kann meine doch gar nicht beurteilen. Die war ja noch nie weg.
W: Glaub’s mir. Meine Frau, die war schon oft weg. Und immer, wenn sie wieder gekommen ist, hat sie gesagt, zuhause isses doch am schönsten.
B: Glaub’ ich nicht, dass meine das sagen würde. Ich glaub’, wenn die einmal das Meer sehen würde, die würd’ gar nicht wiederkommen.
W: Meine Frau war oft am Meer. Sie sagt immer, »am Meer isses schön. Aber nach zwei Wochen kann ich den Fisch nicht mehr riechen.«
B: Prost.
W: Prost.
B: Freitags kocht meine Frau immer Fisch. Immer Fisch. Seit 20 Jahren, jeden Freitag. Und Senfsoße. Ich glaub’, meine Frau würd’ sich am Meer sauwohl fühlen.
W: Und du?
B: Ich mag keinen Fisch. Fisch hat keine Seele.
W: Woher willst du das denn wissen?
B: Da hab’ ich ’n Gespür für. Du musst so’m Tier ja nur mal in die Augen kucken. Wenn dich ’n Fisch ankuckt, der kuckt wie tot.
W: Du hast doch noch nie ’n toten Fisch gesehen. War ja immer dick Senfsoße drauf.
B: Das spielt keine Rolle. So’n Stück Roastbeef ist auch tot. Aber das siehst du noch, wenn du das anschneidest und der Saft läuft raus, dass das Tier ’ne Seele hat. Ich hab das jetzt im Fernsehen gesehen. Die Buddhisten, die essen kein Fleisch. Die essen nur Fisch, weil Fisch keine Seele hat. Die essen nix, wo ’ne Seele drin ist.
W: Und du machst das umgekehrt.
B: Ich bin ja auch nicht Buddhist. Ich bin ja Christ.
W: Dann erklär’ mir mal, wieso Jesus Christus die Speisung der Zehntausend mit Fisch gemacht hat.
B: Das waren andere Zeiten. Damals waren Rindviecher noch knapper als Fische. Heute wär das kein Problem. Heute würde Jesus Roastbeef nehmen. Oder Pferd. Die machen ja heute Pferdefleischtransporte von Polen bis nach Palästina. Da kennen die nix.
W: Das kannst du aber höchstens als Sauerbraten essen. Das Pferd ist doch schon gammelig, wenn das da ankommt. Da muss ordentlich Essig dran, sonst gehst du kaputt davon. Egal, ob du Christ bist oder Buddhist.
B: In Palästina gibt’s keine Buddhisten.
W: Kein Wunder, bei dem vielen Pferdefleisch aus Polen.
B: Prost.
W: Prost.
B: Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
W: Was?
B: Ob ich meine Frau ans Meer fahren lass’. Ich glaub’, die kommt dann nicht wieder.
W: Die kommt wieder. Zuhause isses doch am schönsten.
B: Ja, vielleicht sollte ich sie mal zwei Wochen weg lassen. Dann könnte ich freitags auch mal Fleisch essen.
W: Prost.
B: Prost.
Tasuta katkend on lõppenud.