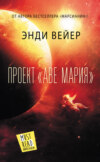Loe raamatut: «Geschichte der deutschen Literatur Band 4»

Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas.wuv · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
A. Francke Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK/Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
vdf Hochschulverlag AG an der ETH · Zürich
Geschichte der deutschen Literatur
Band 1. Humanismus und Barock
Band 2. Aufklärung
Band 3. Goethezeit
Band 4. Vormärz und Realismus
Band 5. Moderne
Gottfried Willems
Geschichte der
deutschen Literatur
Band 4
Vormärz und Realismus
BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN · 2014
Gottfried Willems war Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und
Neueste deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich
unter www.utb-shop.de.
© 2014 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien
Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Satz: synpannier. Gestaltung & Wissenschaftskommunikation, Bielefeld
Druck und Bindung: AALEXX Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in the EU
UTB-Band-Nr. 3874 | ISBN 978-3-8252-3874-2
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
1 Einleitung
1.1 Das 19. Jahrhundert in der Literaturgeschichte
1.2 Literaturgeschichte und Kulturgeschichte
1.3 Modernisierung im 19. Jahrhundert
1.4 Literatur und Modernisierung im 19. Jahrhundert
1.5 Literatur und Politik im 19. Jahrhundert
2 Modernisierungskrisen im Vormärz
2.1 Zeit- und Krisendiagnosen in Immermanns „Epigonen“
2.2 Klassikglaube und Epigonenbewußtsein
2.3 Die Ambivalenz der Individualisierung
2.4 Die Krise der Religion
2.4.1 Modernisierung und Säkularisation
2.4.2 Religionskritik in Immermanns „Epigonen“
2.4.3 Die Vorstellung vom „Himmel auf Erden“
3 Vormärz und „Weltschmerz“
3.1 Gutzkows „Wally, die Zweiflerin“
3.2 Nihilismus und Vitalismus bei Heine
3.2.1 „Weltschmerz“ bei Heine
3.2.2 „Ideen. Das Buch Le Grand“
3.3 Nihilismus und Ästhetizismus bei Platen
3.3.1 Platen und Heine
3.3.2 „Weltschmerz“ und „strenge Formkunst“
3.4 Nihilismus, Vitalismus und Humanität bei Büchner
3.4.1 „Dantons Tod“
3.4.2 „Lenz“
3.4.3 Das Kunstgespräch im „Lenz“
3.5 „Die Nihilisten“ von Gutzkow
4 Realismus und „Weltfrömmigkeit“
4.1 Humanität und Vitalismus bei Keller
4.2 Kellers „Das verlorene Lachen“
4.2.1 Aufbau und Handlung
4.2.2 Individuum und Gesellschaft
4.3 Realismus
4.3.1 Desillusionierung
4.3.2 Humor
4.3.3 Sinnlichkeit
4.3.4 Beschreibung
4.4 „Augenfest“ und „Weltfrömmigkeit“
5 Literatur und Nationalismus
5.1 Das Bild der Nationalbewegung bei Immermann
5.1.1 „Die Epigonen“
5.1.2 „Münchhausen“
5.2 Heine als Kritiker des Nationalismus
5.3 Die Vorstellungswelt des Nationalismus
5.3.1 Adam Müller
5.3.2 Johann Gottlieb Fichte
5.3.3 Ernst Moritz Arndt
5.3.4 Friedrich Ludwig Jahn
5.3.5 Joseph Görres
5.4 Lyrik der Befreiungskriege
6 Realismus der Gründerjahre
6.1 Die Gründerjahre im Licht des „Kommunistischen Manifests“
6.2 „Pfisters Mühle“ von Raabe
6.3 Die Frage nach der Zukunft von Poesie und Humanität
Anhang
Siglen
Literaturhinweise
Personenregister
Rückumschlag
1 Einleitung
1.1 Das 19. Jahrhundert in der Literaturgeschichte
„Langes“ oder „kurzes Jahrhundert“?
Wo beginnt das Jahrhundert? Mit der französischen Revolution, mit Napoleon oder mit dem Wiener Kongreß? Mit der Demokratie, dem Militärdespotismus oder der Diplomatie? (GS 2, 69)
So fragte man bereits im 19. Jahrhundert, fragte etwa schon Karl Gutzkow, einer der umtriebigsten und bestinformierten Autoren der ersten Jahrhunderthälfte, in seinen „Zeitdiagnosen“ von 1837. Wenn der Literarhistoriker heute vom 19. Jahrhundert spricht, dann denkt er dabei im allgemeinen noch nicht an die Zeit der Französischen Revolution von 1789 oder an die Ära des „Militärdespoten“ Napoleon – die Zeit von 1799 bis 1815 – und noch nicht einmal an die Jahre im Umfeld des Wiener Kongresses von 1814/15, mit dem die Epoche der Französischen Revolution und des Revolutionskaisers Napoleon an ihr Ende kommt; dies alles wird er noch der „Goethezeit“, der Epoche von Klassik und Romantik zurechnen. Er läßt das 19. Jahrhundert in der Regel erst um 1830, mit dem Ausgang der „Goethezeit“, beginnen, um es bereits um 1890, an der Schwelle zur ästhetischen Moderne, schon wieder enden zu lassen; so hat es sich jedenfalls in der Germanistik eingebürgert.
Die Literaturgeschichte verfährt hier anders als die politische Geschichte, die das 19. Jahrhundert meist als ein „langes Jahrhundert“ behandelt und von der Französischen Revolution von 1789 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 dauern läßt. Denn die Französische Revolution hat das gesamte 19. Jahrhundert beschäftigt; an dem, was damals an politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf den Weg gebracht worden war, hat es sich unausgesetzt abgearbeitet, einschließlich seiner Literatur. Und diese Auseinandersetzung kam erst mit der deutschen Revolution von 1918 zu einem vorläufigen Ende, [<<7] als Deutschland nach dem Debakel des Ersten Weltkriegs der Monarchie den Garaus machte und sich die Verfassung einer Republik gab, so wie es das revolutionäre Frankreich bereits 1792 getan hatte.
In der Literaturgeschichte hat sich eine andere Einteilung durchgesetzt. Hier hat es sich als günstig erwiesen, das 19. Jahrhundert als ein „kurzes Jahrhundert“ zu behandeln und sich bei der Frage nach den epochalen Zusammenhängen mit dem Zeitraum von den dreißiger bis zu den achtziger Jahren zu begnügen. Die Literaturgeschichte ist zwar wie die gesamte Kulturgeschichte eng mit der politischen Geschichte verknüpft, doch verlaufen die Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens keineswegs synchron; was sich in ihnen jeweils als Epoche abzeichnet, läßt sich nur selten zur Deckung bringen, im Grunde nie. Denn wie die Menschen leben, was sie denken und tun, was sie an Haltungen und Vorstellungen entwickeln und in ihrer Literatur ausarbeiten und reflektieren, ändert sich nicht mit einem politischen Ereignis, von einem Tag zum andern; solcher Wandel braucht stets einen längeren Atem.
Um 1830 endet für die Literaturgeschichte die Goethezeit, die Epoche von Spätaufklärung, Klassik und Romantik, und sie endet im Grunde ohne einen äußeren Anhaltspunkt in der politischen Geschichte, ohne Bezug auf ein markantes politisches Datum. Und um 1890 erlebt sie einen weiteren tiefen Einschnitt, wiederum ohne einen solchen Bezugspunkt – und gerade hier ist das Auseinanderklaffen von Ereignisgeschichte und kultureller Entwicklung besonders deutlich – insofern nun mit den Bewegungen des Naturalismus und des Symbolismus, mit Arno Holz und Gerhart Hauptmann, Stefan George, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke etwas durchaus Neues beginnt: die moderne Literatur im engeren und eigentlichen Sinne, die ästhetische Moderne mit ihrem programmatischen Modernismus und ihren immer neuen Avantgarden.
Vormärz, Realismus, Gründerzeit
Die Zeit von 1830 bis 1890 wird in der Regel wiederum in zwei Epochen unterteilt, in die Jahre vor und nach 1850. Der Abschnitt vor 1850 umfaßt die späteste Romantik, das Biedermeier und den Vormärz, wie er sein Profil wesentlich der literarisch-politischen Bewegung des „Jungen Deutschland“ verdankt. Vormärz: so nennt man die Jahrzehnte vor der Märzrevolution von 1848, vor den beiden Revolutionsjahren 1848 und 1849. Aus der Vormärzzeit haben sich vor allem die Namen von [<<8] Heinrich Heine (1797–1856) und Georg Büchner (1813–1837) im kulturellen Gedächtnis erhalten, und so soll ihr Werk hier denn auch mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht werden. Daneben sollen einige Arbeiten des Heine-Freunds Karl Leberecht Immermann (1796–1840) und des Büchner-Förderers Karl Ferdinand Gutzkow (1811–1878) mit herangezogen werden, als von Autoren, bei denen das Typische des Vormärz besonders deutlich zu greifen ist.
Und die Jahre nach 1850 gelten als Epoche des Realismus, oder, wie vielfach auch zu lesen ist, des „bürgerlichen Realismus“ oder „poetischen Realismus“. Hier ist in erster Linie an Adalbert Stifter (1805–1868), Friedrich Hebbel (1813–1863), Theodor Storm (1817–1888), Gottfried Keller (1819–1890), Theodor Fontane (1819–1898), Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898) und Wilhelm Raabe (1831–1910) zu denken, aber auch an Autoren, die heute nicht mehr ganz so bekannt sind, etwa an Otto Ludwig (1813–1865), Gustav Freytag (1816–1895) und Friedrich Spielhagen (1829–1911).
Diese Aufteilung ist freilich nicht ohne Probleme, wie jede Einteilung in Epochen. So gehört zum Beispiel der konsequenteste und radikalste der Realisten, Büchner, bereits der Epoche des Vormärz an und nicht, wie man vermuten möchte, erst der des Realismus; Büchner ist ja schon 1837 im Alter von 23 Jahren gestorben. Mit Epochenbegriffen ist es nun einmal nicht anders: sie sind nicht zu entbehren, wo man sich ein Bild von der Literaturgeschichte machen will, aber wer zu rigide Begriffe von ihnen hat und sich zu starr an bestimmte Daten klammert, den können sie mit Blindheit schlagen.
Für die Zeit nach 1871 gebraucht man auch gerne den Begriff der Gründerzeit oder Gründerjahre. Damit sind die Jahrzehnte nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 und der Wieder- oder Neugründung des Deutschen Reichs durch Otto von Bismarck mit ihren vielen großen und kleinen Gründergestalten gemeint, wobei nicht nur an politische Größen, sondern auch an solche des Wirtschaftslebens zu denken ist, an die Gründer von Industriebetrieben, Handelshäusern und Banken. Denn es handelt sich um die Zeit eines gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwungs, um die Jahre, in denen die Industrialisierung in Deutschland in ihre entscheidende Phase eingetreten und zu einem flächendeckenden Phänomen geworden ist. Die Gründerzeit wird im allgemeinen noch der Epoche des Realismus [<<9] zugeschlagen, als deren zweite Phase; das Gros der Literatur, die dem „bürgerlichen“ oder „poetischen Realismus“ zugerechnet wird, ist ja auch erst hier entstanden.
1.2 Literaturgeschichte und Kulturgeschichte
Prinzipien der Darstellung
Damit ist der Zeitraum umrissen, dessen Literatur hier zum Gegenstand einer Einführung werden soll. Mit Einführung ist nun keineswegs gemeint – um noch einmal einige der Prinzipien in Erinnerung zu rufen, die im Vorwort zu Band 1 dieser Literaturgeschichte dargelegt worden sind – daß im folgenden auf eine besonders elementare Weise von der Literatur des 19. Jahrhunderts gehandelt werden soll; daß es nur um eine erste Orientierung und Basisinformationen für den Anfänger in der Wissenschaft gehen soll, etwa um einen Überblick über die wichtigsten Daten, Namen und Werke. Vielmehr soll versucht werden, möglichst viel von dem in den Blick zu bekommen, was diese Literatur „im Innersten bewegt“; was die Autoren und ihre Leser seinerzeit umgetrieben hat, was für sie die großen Themen, die entscheidenden Fragen und Probleme gewesen sind und was sie für deren Durchdringung und Bewältigung an formalen Lösungen gefunden haben. Der heutige Leser soll damit in die Lage versetzt werden, ein Verständnis, um nicht zu sagen: ein Gefühl für die Texte des 19. Jahrhunderts zu entwickeln, ein Gespür für ihre spezifischen thematischen Obsessionen und formalen Mittel; denn dessen bedarf er vor allem, wenn er mit ihnen ins Gespräch kommen will.
Das kann aber nur gelingen, wenn auf jeden Anspruch der Vollständigkeit verzichtet und eine Auswahl, eine Entscheidung für eine überschaubare Zahl von Autoren und Werken getroffen wird; nur so wird eine Intensität der Auseinandersetzung möglich, die in der Tat ins Zentrum der Verstehensprobleme führt. Dabei kann freilich davon ausgegangen werden, daß das, was sich in solch exemplarischen Studien in Erfahrung bringen läßt, dazu verhilft, auch mit anderen Autoren und Werken besser zurechtzukommen. Denn was den einen Autor umgetrieben hat, hat im allgemeinen auch die anderen beschäftigt, wie die Zeitgenossen überhaupt. Das gilt jedenfalls für die Autoren, deren Werke ein breiteres Publikum erreicht haben und in den Kanon der [<<10] Literaturgeschichte eingegangen sind; wenn sie nicht den Nerv der Zeit getroffen hätten, hätten sie kaum einen solchen Erfolg haben können.
Den Leser erwartet hier also kein lexikalischer Aufmarsch von literaturhistorischen Daten und Fakten, keine auf Vollständigkeit angelegte Aneinanderreihung von Stichwortartikeln zu literarischen Bewegungen, Autoren und Werken. Er wird nicht über alle literarischen Erscheinungen, Strömungen und Gruppierungen informiert werden, mit denen sich die Literaturwissenschaft beim Blick auf das 19. Jahrhundert zu befassen pflegt und die sie unter diesem oder jenem Gesichtspunkt als bedeutsam einstuft. Wer Vollständigkeit sucht, der möge zu einem der vielen Handbücher greifen, die Entsprechendes bieten, zu Autoren-, Werk- und Begriffslexika. Hier soll es vor allem darum gehen, dem Leser einen Zugang zu dem zu eröffnen, was die Literatur des 19. Jahrhunderts „im Innersten bewegt“, ihm möglichst viel von dem mitzugeben, was es ihm erlaubt, ein Verständnis für ihre Texte zu entwickeln und auf eigene Rechnung in das Gespräch mit ihnen einzutreten.
Literatur- und Kulturgeschichte
Dem wird eine Einführung wie diese aber nur genügen können, wenn sie sich an etwas versucht, das man eine Kulturgeschichte der Literatur nennen könnte, oder auch eine Literaturgeschichte der Kultur, genauer: wenn sie beides in einem zu geben versucht, eine Geschichte der Kultur, wie sie sich in der Literatur bezeugt, und eine Geschichte der Literatur, wie sie sich an den kulturgeschichtlichen Gegebenheiten abarbeitet. Denn die Literatur bezieht ihre Stichworte, ihre Motive und Fragen sowie die Möglichkeiten zu deren Verhandlung weithin aus den geschichtlich-gesellschaftlichen Verhältnissen, in die sie eingelassen ist, und aus dem Repertoire von Vorstellungen, von Diskursen, die ihr die zeitgenössische Kultur zur Verfügung stellt. Insofern läßt sich Literaturgeschichte nur als Kulturgeschichte schreiben; ohne das Eingehen auf die weiteren kulturgeschichtlichen Zusammenhänge, in die die Autoren und ihre Werke eingebettet sind, würde die Auseinandersetzung mit ihnen zu einem windigen Unternehmen, bliebe sie notwendigerweise beliebig und oberflächlich.
Die anthropologische Dimension der Literatur
Dabei ist allerdings zu bedenken, daß die Literatur nicht völlig in der Kulturgeschichte und den historischen „Diskurskonstellationen“ aufgeht. Es bleibt immer ein Rest, jedenfalls bei den Werken von Bedeutung, und gerade dieser Rest ist für den Leser im allgemeinen [<<11] von besonderem Interesse. Nicht alle Fragen der Literatur sind gleichermaßen kulturgeschichtliche Fragen. Die Literaturgeschichte weiß von einer Fülle von Themen, die den geschichtlichen Wandel überdauern, von einem Grundbestand an Fragen, die mit dem Menschsein überhaupt zu tun haben, die von anthropologischer Bedeutung sind. Gerade diese hat die Literatur seit jeher mit Vorliebe aufgesucht, wie immer die geschichtlich-gesellschaftlichen Verhältnisse ausgesehen haben mögen, unter denen sie ihnen Ausdruck zu verleihen suchte.
Man denke nur an Themen wie Liebe und Tod, wie Begehren, Sehnsucht, Hoffnung, Erfüllung und Enttäuschung, wie Freundschaft und Rivalität, Macht und Ohnmacht, Glück und Unglück, Erfolg und Scheitern, Schuld und Unschuld. Was heißt es, Kind zu sein, heranzuwachsen, sich einen Platz im Leben zu suchen, sich mit anderen Menschen und mit einem gesellschaftlichen Umfeld ins Verhältnis zu setzen, Anerkennung zu gewinnen, Anerkennung zu verlieren, alt zu werden und sein Leben hinter sich zu haben? Was heißen Schicksal, Freiheit, Gerechtigkeit? Was ist der Mensch und was ist ihm die Welt? Die Reihe der Fragen, die die Literatur zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden gleichermaßen beschäftigt haben, ließe sich unschwer verlängern.
Der literarische Text als Dokument und Monument
Gerade um solcher und ähnlicher Fragen willen sind literarische Texte der Vergangenheit nicht nur für den Historiker interessant, zählen sie nicht nur als Dokumente, als historische Quellen für die Erkenntnis bestimmter kulturgeschichtlicher Verhältnisse und Entwicklungen, gewinnen sie vielfach darüber hinaus auch die Qualität von Monumenten, von Werken, die die Menschen über allen Wandel der Verhältnisse hinweg immer wieder neu anzusprechen und zu erreichen vermögen, kann es zum Beispiel für uns als Menschen des 21. Jahrhunderts interessant sein, uns Werke des 19. Jahrhunderts zu Gemüte zu führen. Solches Dauern-Können, solches Interessant-bleiben-Können verdankt die Literatur vor allem ihren ästhetischen Qualitäten; diese machen es ihr möglich, jene ewigen Probleme des Menschen so auszuarbeiten, daß ihre Werke über den Wechsel der Zeiten hinweg faszinierend und aufschlußreich bleiben.
Es ist freilich nicht allein der „monumentale“ Charakter, der uns die Literatur des 19. Jahrhunderts nahebringt; es sind durchaus auch die Züge, die sie zu einem Dokument der geschichtlichen Verhältnisse [<<12] und Prozesse machen. Denn diese markieren Stationen eines Wegs, auf dem wir heute noch immer begriffen sind. Sie bezeichnen nämlich Etappen in dem Prozeß, den die moderne Sozialwissenschaft Modernisierung nennt. Die geschichtlich-gesellschaftlichen Verhältnisse und Prozesse, die sich in der Literatur des 19. Jahrhunderts bezeugen und mit denen sie sich auseinandersetzt, ergeben sich wesentlich aus dem Projekt und den Problemen der Modernisierung, und diese sind heute im Prinzip noch dieselben wie im 19. Jahrhundert.
1.3 Modernisierung im 19. Jahrhundert
Der Glaube an den Fortschritt
Wenn man die geschichtlich-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Literatur des 19. Jahrhunderts entstanden ist, auf eine kurze Formel bringen wollte, so könnte man sagen: die Welt wird modern, sie wird nun ein für allemal, auf unumkehrbare Weise modern. Zwar nimmt sich das meiste von dem, was aus dem 19. Jahrhundert auf uns gekommen ist – Stadtlandschaften, Gebäude, Möbel und andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs, Bilder und die Menschen und Dinge, die in ihnen dargestellt sind – in unseren Augen inzwischen reichlich altmodisch aus, trägt es für uns deutlich das Gepräge des Überholten. Doch wissen wir zugleich, daß es dem, was uns selbst zur Zeit gerade als modern gilt, nicht anders ergehen wird; daß man auch darauf binnen kurzem als auf etwas Veraltetes zurückblicken wird. In der modernen Welt ist es nun einmal nicht anders: jeder erlebt nur seine unmittelbare Gegenwart als modern und empfindet alles Frühere als Schnee von gestern. Vor allem an dieser Dynamik des ständigen Überholens und Überholtwerdens, genauer: an dem Bewußtsein von solcher Dynamik, an dem allgegenwärtigen Gefühl des Verfallenseins an die Geschichte erkennt man die Moderne.
Die Welt wird modern – das heißt zunächst, daß der Glaube unter den Menschen mehr und mehr an Boden gewinnt, die Gesellschaft bedürfe des Fortschritts, und daß dieser Glaube immer entschiedener ihr Handeln bestimmt; daß er sich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Geltung verschafft, von der großen Politik und dem staatlichen Verwaltungshandeln bis hin zu den Lebensformen, die den Alltag der kleinen Leute bestimmen, von der Wirtschaft und [<<13] der Arbeitswelt bis hin zu den Bezirken der Kultur im engeren Sinne, bis hin zu Bildung und Erziehung, Religion, Wissenschaft, Kunst und Literatur. In Worten Gutzkows:
Modern ist es, die Welt anzuerkennen, wie sie geworden ist, aber das Recht zu bezweifeln, ob sie so bleiben darf, wie sie ist. (GS 2, 131)
Eben in diesem Sinne wird die Welt im 19. Jahrhundert modern. Der Begriff des Fortschritts wird zu einem Schlüsselwort in allen gesellschaftlichen Diskursen.
Eine Gesellschaft ist dann eine moderne, wenn in ihr der Glaube zu einer bestimmenden Macht geworden ist, daß sie sich ständig modernisieren müsse, daß sie nur dann etwas tauge und eine Zukunft habe, wenn sie jederzeit und überall am Fortschritt arbeite. Solcher Glaube lebt aus der Überzeugung, daß alles, was der Mensch tut und macht, von Veraltung bedroht sei und deshalb immer wieder durch Neues, Besseres ersetzt werden müsse. Der Glaube an den Modernisierungsbedarf aller menschlichen Dinge ist vor allem von der Aufklärung des 18. Jahrhunderts auf den Weg gebracht worden. In der Französischen Revolution von 1789 ist dann sichtbar geworden, welche Dimensionen die Modernisierung annehmen kann und was ihre Chancen, aber auch ihre Gefahren sind. Und im 19. Jahrhundert ist die Welt schließlich in endlosen Kontroversen um das Wohl und Wehe des Fortschritts in einen Modernisierungswirbel hineingerissen worden, der sich bis heute ständig beschleunigt hat und sich offenbar immer nur weiter beschleunigen kann. So kann Gutzkow schon 1837 feststellen: „Alles ist Hebel für die Zukunft geworden (…)“ (GS 2, 119).
Fortschritt und Wissenschaft
Die wichtigste Quelle der Modernisierung ist die Wissenschaft, sind vor allem die modernen Naturwissenschaften; die Wissenschaft ist für die moderne Gesellschaft so etwas wie die zentrale Agentur des Fortschritts. Denn sie ist dank ihrer eigentümlichen Forschungslogik unausgesetzt damit beschäftigt aufzuzeigen, daß man die Dinge auch anders sehen und machen kann als bis dato üblich, und das heißt, daß sie ständig altgewohnte Vorstellungen und Praktiken für überholt erklärt und damit einen immer neuen Modernisierungsbedarf definiert. Modern ist, „(a)lles durch Rede und Schrift in Erörterung zu ziehen“ (GS 2, 146). In eben diesem Sinne ist die Wissenschaft im [<<14] 19. Jahrhundert zu einem unentbehrlichen Faktor, ja zu einem Eckpfeiler des gesellschaftlichen Lebens geworden.
Man kann das schon äußerlich daran erkennen, daß die Institutionen, die dem Erwerb und der Ausbreitung des wissenschaftlichen Wissens dienen, hier in völlig neue Dimensionen hineinwachsen, von den Universitäten bis hin zu den höheren Schulen und den anderen Einrichtungen von Forschung und Lehre. Das Wissen, mit dem sich die Gesellschaft organisiert und ihre Geschäfte betreibt, erfährt eine durchgreifende Akademisierung, ja die Gesellschaft selbst wird mehr und mehr akademisch. Immer mehr Menschen studieren, werden mit einer akademischen Ausbildung ausgestattet, um in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft mit dem neuesten Wissen der Wissenschaft für die Modernisierung tätig zu werden. Das heißt auch, daß man ohne akademische Diplome nun nicht mehr viel werden kann.
Industrielle Revolution
Der wichtigste Transformator für die Modernisierungsenergie, die durch die Wissenschaft erzeugt und freigesetzt wird, ist die Arbeitswelt, und hier wiederum besonders jener Bereich, in dem sich die Organisation der Arbeit vollzieht, die Ökonomie; diese gibt sich zu eben diesem Zweck die Form der modernen kapitalistischen Wirtschaft. So kann das von der Wissenschaft erarbeitete neue Wissen, können insbesondere die von ihr ermöglichten neuen technischen Produktionsverfahren in großem Stil umgesetzt werden. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der „industriellen Revolution“, des Übergangs zu der von der Wissenschaft ermöglichten technisch-industriellen Produktionsweise, ein Prozeß, der in der ersten Jahrhunderthälfte zunächst vor allem in England Fahrt aufgenommen hat – aus England kommen die Dampfmaschine, die Eisenbahn und viele andere Leittechniken der industriellen Revolution – um in der zweiten Jahrhunderthälfte und insbesondere in den Gründerjahren dann auch weite Teile Deutschlands zu erfassen.
Soziale Dynamik und „soziale Frage“
Die Industrialisierung erzeugt eine soziale Dynamik, die nach und nach von immer mehr Menschen Besitz ergreift. Alle Verhältnisse geraten in Bewegung, „Ruhe wird unmöglich“ (GS 2, 119). Modernisierung heißt wesentlich „Mobilmachung“, Mobilisierung der Massen. Immer mehr Menschen werden in Bewegung versetzt, werden aus ihrer gewohnten Umgebung, aus der Welt ihrer Herkunft herausgerissen, um an andere Orte und in andere soziale Zusammenhänge verpflanzt [<<15] zu werden; sie werden, wie man es seinerzeit empfunden hat, ihrer Wurzeln beraubt, erleiden eine „Entwurzelung“.
Dank der modernen Landwirtschaft mit ihrer reicheren Produktion von Lebensmitteln und dank der Segnungen der modernen wissenschaftlichen Medizin und Hygiene wächst die Bevölkerung. Dieses Wachstum ist freilich für viele und gerade für weite Teile der Landwirtschaft treibenden Landbevölkerung selbst zunächst mit Verarmung verbunden, da sich zugleich das gesamte Gefüge der Ökonomie im Sinne der kapitalistischen Geldwirtschaft verändert, und damit der Zugang zu den erwirtschafteten Gütern; es kommt zur Landflucht, wie sie die Menschen bald in die nahen Städte und bald in ferne Länder führt, etwa in die neuen amerikanischen Staaten auswandern läßt. Um die neuen Produktionsstätten, die Fabriken herum breiten sich die Städte immer weiter aus; es entsteht die moderne Großstadt. In ihr wächst ein Industrieproletariat heran, das wie die verarmte Landbevölkerung ständig um das Existenzminimum ringen muß. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Pauperismus oder, ins Politische gewendet, von der sozialen Frage.
Zugleich werden einige wenige über der Industrialisierung extrem reich, und das müssen sie auch, denn zur Finanzierung der industriellen Massenproduktion bedarf es gewaltiger Mittel, bedarf es neuer Formen der „Akkumulation von Kapital“ (Karl Marx). Es bildet sich eine neue Schicht der Gesellschaft, die Bourgeoisie, gekennzeichnet durch neue Typen von Besitzbürgertum wie den Kapitalisten, den „Entrepreneur“ – den Unternehmer –, den Industriekapitän, den Finanzjongleur und den Börsenspekulanten, Typen, die bald schon eine große gesellschaftliche Bedeutung erlangen und dementsprechend auch in die Literatur einwandern.
Der Kontrast könnte nicht größer sein: hier die neuen Superreichen – da die verarmte Landbevölkerung und das kaum weniger arme Industrieproletariat. „Durch alle unsere Verhältnisse“, konstatiert Gutzkow, „zieht sich der gewaltige sociale Riß, diese klaffende Wunde des Jahrhunderts“ (GS 2, 169). So hat die Dynamik der Modernisierung im 19. Jahrhundert unausgesetzt sozialen Sprengstoff produziert; die Kollateralschäden des Fortschritts werden unübersehbar.
Progressiv vs. konservativ
Darauf konnte und kann man auf unterschiedliche Weise reagieren. Zwei typische Wege zeichnen sich bereits zu Beginn des [<<16] 19. Jahrhunderts deutlich ab. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die die negativen Folgen des Fortschritts durch ein Noch-Mehr an Fortschritt, durch einen besseren, tiefergreifenden, fortschrittlicheren Fortschritt überwinden wollen – der Weg der Progressiven, der sich alles in allem durchgesetzt hat und bis heute in den meisten praktischen Belangen den Kurs der Gesellschaft bestimmt. Und da sind auf der anderen Seite diejenigen, die den Fortschritt an die Kette legen, im Rückgriff auf die Tradition begrenzen, zähmen, domestizieren wollen, die ihn in altbewährte Strukturen einfangen und so eine gewisse Stabilität in den Wandel bringen wollen – der Weg der Konservativen.
Solche konservativen Gedanken haben das 19. Jahrhundert nicht weniger bewegt als der Fortschritt, weshalb man von ihm auch als von einer Zeit der „defensiven Modernisierung“ (Hans-Ulrich Wehler) gesprochen hat. Sie haben sich vor allem an den Mobilisierungseffekten der Modernisierung entzündet, an der immer weiter um sich greifenden, immer totaler werdenden Mobilmachung von Natur und Gesellschaft, über der sich die Welt in einen einzigen gewaltigen Verschiebebahnhof für Menschen und Dinge zu verwandeln schien – an eben dem, was man „Entwurzelung“ nannte. Und so ist das 19. Jahrhundert nicht nur ein Jahrhundert der Begeisterung für den Fortschritt geworden, sondern zugleich auch das Jahrhundert des Historismus, einer immer intensiveren Beschäftigung mit dem kulturellen Erbe, insbesondere mit überkommenen Modellen einer weniger mobilen, stabiler scheinenden Gesellschaftsordnung.