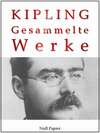Loe raamatut: «Hans Fallada – Gesammelte Werke», lehekülg 16
»Dieses ganze Volk ist ein Volk von Wahnsinnigen geworden, einer steckt den anderen an!«
»Wenn man diesen Kerl erwischte, der andere in solche Schwierigkeiten bringt! Ich würde mich direkt freuen …«
»Ach, lass doch! Du würdest dich bestimmt nicht freuen, wenn noch einer mehr sterben würde. Aber wie kommen wir aus diesen Schwierigkeiten heraus?«
Der Anwalt sah nachdenklich wieder auf die Karte. Dann griff er zum Telefon. »Wir haben hier irgend so einen Politischen Leiter im Hause«, sagte er erklärend zum Freunde. »Ich werde ihm die Karte offiziell übergeben, den Sachverhalt schildern, wie er tatsächlich war, im Übrigen aber der Sache keine große Wichtigkeit beimessen. Du bist deiner Aussage sicher?«
»Völlig.«
»Und deiner Nerven?«
»Ganz gewiss, mein Lieber. Auf der Bühne habe ich noch nie Lampenfieber gehabt. Vorher immer! Was für eine Art Mann ist dieser Politische Leiter?«
»Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht, ihn je gesehen zu haben. Wahrscheinlich irgend so ein kleiner Bonze. Jedenfalls rufe ich ihn jetzt an.«
Aber das Männlein, das kam, sah nicht sehr nach Bonze aus, eher nach einem Fuchs, der sich aber sehr geschmeichelt fühlte, als er den berühmten Schauspieler kennenlernte, den er so oft schon im Film gesehen. Und aus dem Stegreif nannte er sechs Filme; in deren keinem der Schauspieler je mitgespielt hatte. Max Harteisen bewunderte das Gedächtnis des Männleins, dann gingen sie zum geschäftlichen Teil dieses Besuches über.
Das Füchslein las die Karte, und seinem Gesicht war nicht abzulesen, was der Mann dabei empfand. Es war nur schlau. Dann hörte er den Bericht von dem Auffinden der Karte, der Ablieferung hier auf dem Büro.
»Sehr gut. Sehr korrekt!«, lobte der Leiter. »Und wann war das etwa?«
Einen Augenblick stutzte der Anwalt, warf einen raschen Blick auf den Freund. Besser nicht lügen, dachte er. Sie haben ihn mit der Karte in der Hand sehr erregt hereinkommen sehen.
»Vor einer guten halben Stunde«, meinte der Anwalt.
Das Männlein zog die Augenbrauen hoch. »So lange?«, fragte er mit leisem Erstaunen.
»Wir hatten noch anderes zu besprechen«, erklärte der Anwalt. »Wir legten der Sache keine große Wichtigkeit bei. Oder ist sie wichtig?«
»Wichtig ist alles. Wichtig wäre es gewesen, diesen Burschen, der die Karte niederlegte, zu fangen. Aber jetzt nach einer halben Stunde ist es dafür natürlich viel zu spät.«
Jedes seiner Worte klang von einem leichten Vorwurf gegen dieses »Zuspät« wider.
»Ich bedaure diese Verspätung«, sagte der Schauspieler Harteisen tönend. »Sie entstand durch meine Schuld. Ich nahm meine Angelegenheiten wichtiger als dieses – Geschmier!«
»Ich hätte es besser wissen müssen«, sagte der Anwalt.
Das Füchslein lächelte beschwichtigend. »Nun, meine Herren, was zu spät ist, bleibt zu spät. Es freut mich jedenfalls, dass ich auf diese Weise den Vorzug genossen habe, Herrn Harteisen persönlich kennenzulernen. Heil Hitler!«
Sehr stark, aufspringend: »Heil Hitler!«
Und als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, sahen sich die beiden Freunde an.
»Gott sei Dank, wir sind diese unselige Karte los!«
»Und er hat keinen Verdacht auf uns!«
»Nicht wegen der Karte! Dass wir aber zwischen Ablieferung und Nichtablieferung geschwankt haben, das hat er sehr wohl begriffen.«
»Glaubst du, dass noch etwas nach der Sache kommt?«
»Nein, eigentlich nicht. Im schlimmsten Falle eine belanglose Vernehmung, wo und wann und wie du die Karte gefunden hast. Und da gibt es ja nichts zu verheimlichen.«
»Weißt du, Erwin, eigentlich bin ich jetzt ganz froh, aus dieser Stadt eine Weile herauszukommen.«
»Siehst du!«
»Man wird schlecht in dieser Stadt!«
»Man wird es! Man ist es schon! Und das kräftig!«
Unterdes war das Füchslein auf seine Ortsgruppe gefahren. Ein Braunhemd hielt jetzt die Karte in der Hand.
»Das geht nur die Gestapo an«, sagte das Braunhemd. »Du fährst am besten selbst damit hin, Heinz. Warte, ich gebe dir ein paar Zeilen mit. Und die beiden Herren?«
»Völlig außer Frage! Natürlich, politisch zuverlässig sind sie beide nicht. Ich sage dir, sie haben Blut und Wasser geschwitzt, als sie mit der Karte anfangen mussten.«
»Der Harteisen soll bei Minister Goebbels in Ungnade sein«, meinte das Braunhemd nachdenklich.
»Trotzdem!«, sagte das Füchslein. »Er würde so was nie wagen. Hat viel zu viel Angst. Ich habe ihm ins Gesicht sechs Filme genannt, in denen er nie aufgetreten ist, und habe seine Meisterleistung bewundert. Er hat eine Verbeugung nach der anderen gemacht und gestrahlt vor Dankbarkeit. Dabei habe ich direkt gerochen, wie er vor Angst geschwitzt hat!«
»Alle haben sie Angst!«, entschied das Braunhemd verächtlich. »Warum eigentlich? Es ist ihnen doch so leichtgemacht, sie brauchen nur zu tun, was wir ihnen sagen.«
»Das ist, weil die Leute das Denken nicht lassen können. Sie glauben immer, mit Denken kommen sie weiter.«
»Sie sollen bloß gehorchen. Das Denken besorgt der Führer.«
Das Braunhemd tippte auf die Karte: »Und der hier? Was meinst du zu dem, Heinz?«
»Was soll ich dazu sagen? Wahrscheinlich hat er wirklich den Sohn verloren …«
»I wo! Die so was schreiben und tun, das sind immer bloß Hetzer. Die wollen was für sich erreichen. Söhne und ganz Deutschland, das ist ihnen alles ganz egal. Irgend so ein alter Sozi oder Kommunist …«
»Glaube ich nicht. Glaube ich nie und nimmer im Leben. Die können doch von ihren Phrasen nicht lassen, Faschismus und Reaktion und Solidarität und Prolet – aber von all diesen Schlagworten steht nicht eins auf der Karte. I wo, was ein Sozi ist oder ein Kommunist, das rieche ich auf zehn Kilometer gegen den Wind!«
»Und ich glaub’s doch! Die haben sich jetzt alle getarnt …«
Aber die Herren auf der Gestapo waren auch nicht der Meinung des Braunhemdes. Übrigens wurde der Bericht des Füchsleins dort mit heiterer Ruhe aufgenommen. Dort war man immerhin schon andere Dinge gewohnt.
»Na ja«, sagten sie. »Schön und gut. Werden ja sehen. Wenn Sie sich vielleicht noch zu Kommissar Escherich bemühen wollen, wir verständigen ihn telefonisch, der wird die Sache bearbeiten. Geben Sie ihm noch einmal genauen Bericht, wie sich die beiden Herren verhielten. Natürlich geschieht im Augenblick nichts gegen sie, nur als Material für etwaige spätere Fälle kann so was nützlich sein, Sie verstehen doch …?«
Kommissar Escherich, ein langer, schlenkriger Mann mit einem losen, sandfarbenen Schnurrbart, in einem hellgrauen Anzug – alles an diesem Menschen war so farblos, dass man ihn gut für eine Ausgeburt des Aktenstaubes halten konnte –, also, Kommissar Escherich drehte die Karte zwischen den Händen hin und her.
»Eine neue Platte«, meinte er dann. »Die habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Schwere Hand, hat nicht viel geschrieben in seinem Leben, immer mit der Hand gearbeitet.«
»Ein Kapediste?«, fragte das Füchslein.
Der Kommissar Escherich kicherte: »Machen Sie doch keine Witze, Herr! So was und ein Kapediste! Sehen Sie, wenn wir eine richtige Polizei hätten und die Sache wäre es wert, so wäre der Schreiber da in vierundzwanzig Stunden hinter Schloss und Riegel.«
»Und wie würden Sie das machen?«
»Das ist doch ganz einfach! Ich ließe überall in Berlin recherchieren, wem in den letzten zwei, drei Wochen ein Sohn gefallen ist, einziger Sohn wohlgemerkt, denn der Schreiber hat nur einen Sohn gehabt!«
»Woran sehen Sie denn das?«
»Das ist doch ganz einfach! Im ersten Satz, wo er von sich spricht, sagt er so. Im zweiten, bei den anderen, spricht er von Söhnen. Na, und auf die das dann zutrifft mit den Recherchen – es können gar nicht so viel sein in Berlin –, auf die hätte ich dann mein Augenmerk, und schon säße der Schreiber drin!«
»Aber warum tun Sie’s nicht?«
»Ich hab’s Ihnen doch schon gesagt, weil wir den Apparat dazu nicht haben und weil’s die Sache nicht wert ist. Sehen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schreibt der noch zwei, drei Karten, und dann hat er’s über. Weil’s ihm zu viele Mühe macht oder weil das Risiko ihm zu groß ist. Dann hat er nicht viel Schaden angerichtet, man hat aber auch nicht viel Arbeit von ihm gehabt.«
»Glauben Sie denn, dass hier alle Karten abgegeben werden?«
»Alle nicht, aber die meisten doch. Das deutsche Volk ist schon recht zuverlässig …«
»Weil sie alle Angst haben!«
»Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass dieser Mann«, er klopfte mit dem Knöchel auf die Karte, »dass dieser Mann Angst hat. Sondern ich glaube, es tritt die zweite Möglichkeit ein: der Mann wird immer weiter schreiben. Lass ihn, je mehr er schreibt, umso mehr verrät er sich. Jetzt hat er nur ein kleines bisschen von sich verraten, nämlich, dass er einen Sohn verloren hat. Aber mit jeder Karte wird er mir ein bisschen mehr von sich verraten. Ich brauche gar nicht viel dazu zu tun. Ich brauche hier nur zu sitzen, ein bisschen aufzupassen, und – schnapp! – habe ich ihn! Wir hier auf unserer Abteilung brauchen nur Geduld zu haben. Manchmal dauert es ein Jahr, manchmal noch mehr, aber schließlich kriegen wir unsere Leute alle. Oder fast alle.«
»Und was dann?«
Der Staubfarbige hatte einen Stadtplan von Berlin vorgeholt und an der Wand festgemacht. Nun steckte er ein rotes Fähnchen ein, genau dort, wo das Bürohaus in der Neuen Königstraße stand. »Sehen Sie, das ist alles, was ich im Augenblick tun kann. Aber in den nächsten Wochen werden immer mehr Fähnchen dazukommen, und dort, wo sie am dicksten sitzen, da steckt mein Klabautermann. Weil er nämlich mit der Zeit abstumpft und weil es ihm den weiten Weg nicht mehr lohnt wegen einer Karte. Sehen Sie, an diese Karte denkt der Klabautermann nicht. Und ist doch so einfach! Und schnapp mache ich noch einmal und habe ihn auch so fest!«
»Und was dann?«, fragte das Füchslein, von einer lüsternen Neugier angetrieben.
Kommissar Escherich sah ihn ein bisschen spöttisch an. »Hören Sie’s so gerne? Na, ich tu Ihnen den Gefallen: Volksgerichtshof und weg mit der Rübe! Was geht das mich an? Was zwingt den Kerl, so ’ne blöde Karte zu schreiben, die kein Mensch liest und kein Mensch lesen will! Nee, das geht mich nichts an. Ich bezieh mein Gehalt, und ob ich dafür Marken verkaufe oder Fähnchen einpieke, das ist mir ganz egal. Aber ich werde an Sie denken, ich werde nicht vergessen, dass Sie mir die erste Meldung gebracht haben, und wenn ich den Kerl gefasst habe und es ist so weit, so schicke ich Ihnen eine Einladungskarte für die Hinrichtung.«
»Nee, danke wirklich. So war das nicht gemeint!«
»Natürlich war es so gemeint. Warum genieren Sie sich denn vor mir?! Vor mir braucht sich kein Mensch zu genieren, ich weiß, was mit den Menschen los ist! Wenn wir hier das nicht wüssten, wer soll’s denn sonst wissen? Nicht mal der liebe Gott! Also, abgemacht, ich schicke Ihnen eine Karte zur Hinrichtung. Heil Hitler!«
»Heil Hitler! Und vergessen Sie es auch nicht!«
1 Propagandaminister Goebbels <<<
2 Heinrich Luitpold Himmler war ein deutscher Politiker der NSDAP. Er machte in den 1920er Jahren als Reichsredner und Parteifunktionär Karriere. <<<
21. Ein halbes Jahr danach: Quangels
Ein halbes Jahr später war den beiden Quangels das sonntägliche Schreiben der Postkarten bereits zur Gewohnheit geworden, zu einer heiligen Gewohnheit freilich, die ein Bestandteil ihres täglichen Lebens war wie die tiefe Ruhe, die sie umgab, oder die eiserne Sparsamkeit um jeden Groschen. Es waren die schönsten Stunden der Woche, wenn sie beide an den Sonntagen beisammensaßen, sie in der Sofaecke, mit irgendeiner Flick- oder Stopfarbeit beschäftigt, er steif auf dem Stuhl am Tisch sitzend, den Federhalter in der großen Hand, langsam Wort für Wort hinmalend.
Quangel hatte seine anfängliche Leistung von einer Karte pro Woche jetzt verdoppelt. Ja, an guten Sonntagen brachte er es sogar auf drei Karten. Nie schrieb er aber eine Karte gleichen Inhalts. Sondern beide Quangels entdeckten, je mehr sie schrieben, umso mehr Fehler des Führers und seiner Partei. Dinge, die ihnen, als sie geschahen, kaum als tadelnswert zum Bewusstsein gekommen waren, wie die Unterdrückung aller anderen Parteien, oder die sie nur als zu weitgehend und zu roh durchgeführt verurteilt hatten, wie die Judenverfolgungen (denn wie die meisten Deutschen waren die Quangels im Innern keine Judenfreunde, also mit diesen Maßnahmen einverstanden) – diese Dinge bekamen jetzt, da sie zu Feinden des Führers geworden waren, ein ganz anderes Gesicht und Gewicht. Sie bewiesen ihnen die Verlogenheit der Partei und ihrer Führer. Und wie alle frisch Bekehrten hatten sie das Bestreben, andere zu bekehren, und so wurde der Ton, in dem diese Karten geschrieben wurden, nie monoton, und an Themen gab es keinen Mangel.
Anna Quangel hatte nun längst ihren stillen Zuhörerposten aufgegeben, sie saß lebhaft da im Sofa, sprach mit, schlug Themen vor und dachte Sätze aus. Sie arbeiteten in der schönsten Gemeinsamkeit, und diese tiefe, innere Gemeinsamkeit, die sie nach so langer Ehe jetzt erst kennenlernten, wurde ihnen zu einem großen Glück, das über die ganze Woche hin sein Licht ausstrahlte. Sie sahen sich mit einem Blick an, sie lächelten, jedes wusste von dem anderen, es hatte jetzt an die nächste Karte gedacht oder an die Wirkung dieser Karten, an die ständig wachsende Zahl ihrer Anhänger und dass schon mit Begier auf die nächste Nachricht von ihnen gewartet wurde.
Beide Quangels zweifelten nicht einen Augenblick daran, dass ihre Karten jetzt in den Betrieben heimlich von Hand zu Hand gingen, dass Berlin von diesen Bekämpfern zu sprechen anfing. Sie waren sich klar darüber, dass ein Teil der Karten der Polizei in die Hände fiel, aber sie nahmen an: höchstens jede fünfte oder sechste Karte. Sie hatten so oft an diese Wirkung gedacht und von ihr gesprochen, dass die Weiterverbreitung ihrer Nachrichten, das Aufsehen, das sie erregten, ihnen ganz selbstverständlich erschien, eine Tatsache, die man nicht bezweifeln konnte.
Dabei hatten beide Quangels nicht den geringsten tatsächlichen Anhaltspunkt dafür. Ob Anna Quangel nun vor einem Lebensmittelladen in der Schlange anstand, ob der Werkmeister sich stumm mit seinen scharfen Augen zu einer Gruppe von Schwätzern stellte und eben nur durch sein Dortstehen ihr Geschwätz zum Aufhören brachte – niemals hörten sie ein Wort von dem neuen Kämpfer gegen den Führer, von den Botschaften, die er in die Welt sandte. Aber dieses Schweigen über ihre Arbeit konnte sie nicht wankend machen in dem festen Glauben, dass doch von ihr geredet wurde, dass sie ihre Wirkung tat. Berlin war eine sehr große Stadt, und die Verteilung der Karten erstreckte sich auf ein weites Gebiet, es brauchte seine Zeit, bis das Wissen von ihnen überall einsickerte. Kurz, den Quangels erging es wie allen Menschen: sie glaubten, was sie hofften.
Von den Vorsichtsmaßregeln, die Quangel zu Beginn seiner Arbeit für nötig gehalten hatte, war er nur bei den Handschuhen abgewichen. Genaue Überlegungen hatten ihm gesagt, dass diese störenden Dinger, die seine Arbeit so verlangsamten, nichts nützten. Seine Karten gingen vermutlich, ehe mal wirklich eine bei der Polizei landete, durch so viele Hände, dass auch der gewiegteste Polizeibeamte nicht mehr ausmachen konnte, was des Schreibers Abdrücke waren. Natürlich beobachtete Quangel weiter die äußerste Vorsicht. Vor dem Schreiben wusch er sich stets die Hände, er fasste die Karten nur sachte und sehr an den Rändern an, und beim Schreiben lag stets ein Löschblatt unter der Schreibhand.
Was das Ablegen der Karten selbst in den großen Bürohäusern anging, so hatte es längst den Reiz der Neuheit verloren. Dieses Ablegen, das ihnen zuerst so gefahrvoll erschienen war, hatte sich mit der Zeit als der leichteste Teil der Aufgabe erwiesen. Man ging in ein solches belebtes Haus, man wartete den richtigen Augenblick ab, und schon stieg man wieder die Treppe hinunter, ein bisschen erleichtert, von einem Druck in der Magengegend befreit, den Gedanken »Wieder einmal gutgegangen« im Kopf, aber nicht sonderlich aufgeregt.
Zuerst hatte Quangel diese Karten nur allein abgelegt, die Begleitung Annas war ihm sogar unerwünscht erschienen. Aber dann machte es sich von selbst, dass auch dabei Anna tätige Mithelferin wurde. Quangel hielt genau darauf, dass die Karten, ob nun eine oder zwei oder gar drei geschrieben waren, stets am folgenden Tage aus dem Hause kamen. Aber manchmal konnte er wegen seiner von Rheumaschmerzen geplagten Beine schlecht gehen, zum anderen forderte die Vorsicht, dass die Karten in weit voneinander entfernten Stadtteilen verbreitet wurden. Das bedingte zeitraubende Bahnfahrten, die an einem Vormittag durch eine Person kaum zu bewältigen waren.
So übernahm Anna Quangel ihren Anteil auch an dieser Arbeit. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie, dass es sehr viel aufregender und nervenquälender war, vor einem Hause zu stehen und auf den Mann zu warten, als die Karten selbst abzulegen. Dabei war sie stets die Ruhe selbst. Sobald sie ein derartiges Haus betreten hatte, fühlte sie sich sicher in dem Getriebe der treppan und treppab Steigenden, sie wartete geduldig auf ihre Gelegenheit und legte dann rasch die Karten hin. Sie war sich ganz sicher, dass sie niemals bei diesem Ablegen beobachtet war, dass keiner sich ihrer erinnern und eine Beschreibung ihrer Person geben konnte. In Wahrheit war sie auch viel weniger auffallend als ihr Mann mit dem scharfen Vogelgesicht. Sie war eine kleine Bürgersfrau, die eben mal rasch zum Doktor lief.
Nur ein einziges Mal waren die Quangels bei ihrer sonntäglichen Schreiberei gestört worden. Aber auch bei dieser Störung hatte es nicht die geringste Aufregung und Verwirrung gegeben. Wie viele Male schon besprochen, war Anna Quangel bei dem Klingeln leise an die Flurtür geschlichen und hatte nach den Besuchern Ausschau durch das Guckloch gehalten. Unterdes hatte Otto Quangel das Schreibzeug fortgepackt und die angefangene Karte in ein Buch gelegt. Es standen auch hier erst die Worte: »Führer, befiehl – wir folgen! Jawohl, wir folgen, wir sind eine Herde Schafe geworden, die unser Führer auf jede Schlachtbank treiben darf. Wir haben das Denken aufgegeben …«
Die Karte mit diesen Worten hatte Otto Quangel in ein Radiobastelbuch seines gefallenen Sohnes gelegt, und als nun Anna Quangel mit den beiden Besuchern, einem kleinen Buckligen und einer dunklen, langen, müden Frau, eintrat, saß Otto bei seiner Schnitzerei und bosselte an der Büste des Jungen, die schon ziemlich weit vorgeschritten war und auch nach Ansicht Anna Quangels immer ähnlicher wurde. Es erwies sich, dass der kleine Bucklige ein Bruder Annas war; die Geschwister hatten sich fast dreißig Jahre nicht mehr gesehen. Der kleine Buckel hatte stets in Rathenow bei einer optischen Fabrik gearbeitet und war erst vor kurzem nach Berlin geholt worden, um als Spezialist in einer Fabrik zu arbeiten, die irgendwelches Gerät für Unterseeboote herstellte. Die müde, dunkle Frau war Annas noch nie gesehene Schwägerin. Otto Quangel hatte diese beiden Verwandten bisher noch nicht kennengelernt.
An diesem Sonntag wurde es mit der weiteren Schreiberei nichts, die begonnene Karte blieb unvollendet in dem Radiobastelbuch Ottochens liegen. So sehr Quangels auch sonst gegen alle Besuche, gegen Freundschaft und Verwandtschaft eingestellt waren, um der Ruhe willen, in der sie leben wollten, dieser da so unvermutet hereingeschneite Bruder und seine Frau missfielen ihnen nicht. Heffkes waren in ihrer Art auch stille Leute, irgendeiner religiösen Sekte angehörend, die, nach einer Andeutung zu schließen, von den Nazis verfolgt wurde. Aber sie sprachen kaum davon, wie überhaupt alles Politische ängstlich vermieden wurde.
Aber Quangel hörte staunend, wie die beiden, Anna und ihr Bruder Ulrich Heffke, Kindheitserinnerungen austauschten. Zum ersten Mal hörte er es, dass Anna auch einmal ein Kind gewesen war, ein Kind mit Übermut, Unarten und Streichen. Er hatte seine Frau erst kennengelernt, als sie schon ein älteres Mädchen gewesen war; er hatte nie daran gedacht, dass sie einmal ganz anders ausgesehen hatte, vor ihrem arg geplagten, freudlosen Dienstmädchendasein, das ihr so viel von ihrer Kraft und ihrer Hoffnung genommen hatte.
Nun sah er, während die Geschwister miteinander plauderten, das kleine, arme märkische Dorf vor sich; er hörte, dass sie die Gänse hatte hüten müssen, dass sie sich vor der verhassten Arbeit des Kartoffelbuddelns stets versteckt und viele Schläge deswegen bekommen hatte, und er erfuhr, dass sie im Dorfe recht beliebt gewesen war, weil sie sich, trotzig und couragiert, gegen alles aufgelehnt hatte, was ihr nach Ungerechtigkeit schmeckte. Hatte sie doch sogar einem ungerechten Schullehrer dreimal hintereinander mit einem Schneeball den Hut vom Kopfe geworfen – und sie war nie als die Täterin entdeckt worden. Nur sie und Ulrich hatten davon gewusst, Ulrich aber petzte nie.
Nein, dies war kein unangenehmer Besuch, obwohl zwei Karten weniger als sonst geschrieben wurden. Quangels meinten es auch ganz aufrichtig, als sie den Heffkes beim Abschied einen Gegenbesuch versprachen. Sie hielten auch das Versprechen. Etwa fünf oder sechs Wochen später suchten sie die Heffkes in einer kleinen Notwohnung auf, die ihnen im Westen in der Nähe des Nollendorfplatzes frei gemacht worden war. Die Quangels benutzten diesen Besuch, um endlich auch mal im Westen eine Karte abzulegen; obwohl es Sonntag und das Bürohaus wenig belebt war, ging alles gut.
Von da an folgten die gegenseitigen Besuche sich in etwa sechswöchigem Abstand. Sie waren nicht weiter aufregend, aber sie brachten doch ein wenig andere Luft in das Leben der Quangels. Meist saßen Otto und seine Schwägerin schweigend am Tisch und lauschten auf das leise Gespräch der beiden Geschwister, die nicht müde wurden, von ihrer Kindheit zu plaudern. Es tat Quangel gut, auch diese andere Anna kennenzulernen; freilich fand er nie eine Brücke zwischen der Frau, die heute an seiner Seite lebte, und jenem Mädchen, das die Landarbeit verstand, mutwillige Streiche verübte und das trotzdem als beste Schülerin der kleinen Landschule galt.
Sie erfuhren, dass Annas Eltern noch immer in ihrem Geburtsort lebten, sehr alte Leute – der Schwager erwähnte beiläufig, dass er den Eltern monatlich zehn Mark sandte. Anna Quangel war schon drauf und dran, dem Bruder zu sagen, dass sie das von nun an auch tun würden, aber sie fing noch zur rechten Zeit einen warnenden Blick ihres Mannes auf und schwieg.
Erst auf dem Heimweg sagte er dann: »Nein, besser nicht, Anna. Wozu solch alte Leute verwöhnen? Sie haben doch ihre Rente, und wenn der Schwager dazu noch alle Monate zehn Mark schickt, ist das genug.«
»Wir haben doch so viel Geld auf der Sparkasse!«, bat Anna. »Wir werden es nie aufbrauchen. Früher haben wir gedacht, es wäre mal für Ottochen, aber jetzt … Lass es uns tun, Otto! Und wenn es nur fünf Mark sind alle Monate!«
Ungerührt antwortete Otto Quangel: »Jetzt, wo wir in der großen Sache drin sind, wissen wir nicht, wozu wir unser Geld eines Tages noch brauchen werden. Vielleicht werden wir jede einzelne Mark gebrauchen, Anna. Und die alten Leute haben bisher auch ohne uns gelebt, warum nicht weiter so?«
Sie schwieg, ein wenig gekränkt, vielleicht nicht so sehr in ihrer Liebe zu den Eltern, denn sie hatte kaum je an die alten Leute gedacht und ihnen nur einmal im Jahre aus Pflichtgefühl zu Weihnachten einen Brief geschrieben. Aber sie kam sich vor dem Bruder etwas blamiert und schäbig vor. Der Bruder sollte doch nicht denken, sie könnten nicht das, was er konnte.
Anna sagte hartnäckig: »Der Ulrich wird denken, wir können’s nicht, Otto. Er wird von deiner Arbeit gering denken, dass sie nur ganz wenig einbringt.«
»Es ist doch ganz egal, was andere von mir denken«, versetzte Quangel. »Ich hole nun einmal für so was kein Geld von der Kasse.«
Anna fühlte, dieser letzte Satz war unumstößlich. Sie schwieg, sie fügte sich wie immer, wenn solch ein Satz von Otto gesprochen wurde, aber ein bisschen gekränkt war sie doch, dass der Mann nie Rücksicht auf ihre Gefühle nahm. Doch vergaß Anna Quangel diese Kränkung rasch bei der Weiterarbeit am großen Werk.