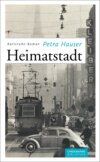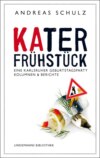Loe raamatut: «Kunst oder Das Brummen des Rentierweibchens»

Horst Koch
Kunst oder
Das Brummen des
Rentierweibchens
Roman

Horst Koch, geboren 1945, studierte Volkswirtschaftslehre, Wissenschaftstheorie und Philosophie. Er war für Banken und Ministerien in Frankfurt, Stuttgart und Karlsruhe tätig. In Lindemanns Bibliothek erschienen von ihm der Szenethriller „Indianerplatz“ (2013) sowie der Euro-Thriller „Stein“ (2015). www.horstkoch.com
Lindemanns Bibliothek, Band 264
herausgegeben von Thomas Lindemann
© 2016 · Info Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck ohne Genehmigung
des Verlages nicht gestattet.
ISBN 978-3-88190-914-3
www.infoverlag.de
Anfang
Ich weiß nicht, womit und mit wem ich anfangen soll. Das ist ein doofes Bekenntnis für einen Schriftsteller. Aber was soll ich machen, da es keine eindeutige Hauptfigur gibt in dieser Erzählung? „Anfangen“!, sagt eine alte Weisheit. Also, ich fange mit Bunker an, auch wenn gerade der nicht besonders interessant ist. Bunker war Banker. Sachlich unpassender und deshalb passend boshafter Weise wird er von den anderen – auf die komme ich noch – Bunker genannt. Der ist intelligent, hält Kunst für einen netten Hokuspokus, also so etwas wie eine säkulare Religion, eine akzeptable Ruhestandsbeschäftigung, die letzte Zwischenstation auf dem Weg zum Friedhof – jedenfalls am Anfang. Besinnt er sich eines anderen? Ich weiß es noch nicht.
Wichtig ist: Er kämpft um Kunstverständnis, um Kunstnähe. Er macht sich auch immer wieder Gedanken, die er auf Zetteln notiert, damit sie auf ihn zurückwirken können. Manchmal sehe ich ihm dabei über die Schulter oder krame in seinem Papierkorb nach zerknülltem Papier und werde oft auch fündig. So eine zerknüllte Weisheit, die im Kampf um Kunstnähe entstanden sein muss und die ich mir gemerkt habe, lautet:
Beständig dieses Kratzen an den Festungsmauern von Transzendenz. Das ist es doch, was Kunst macht, oder? Und was ist Transzendenz? Ach so: Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, ... dass ich dich sehe, du mich siehst. Ist diese augenblickliche Begegnung von Blicken transzendent, ins Unendliche ausgreifend – in irgendeiner geheimnisvollen Dimension? Da müsste das Kunstwerk ja zurückblicken, um an dieser Transzendenz teilzuhaben. Gibt es das? „Wir sehen dich“ hat ein berühmter Künstler eine Großinstallation in einem Museum genannt. Muss man lernen, gesehen zu werden, um Kunst zu verstehen? Wer sieht einen da, das Kunstwerk, der Künstler, der Kunstbetrachter sich selbst? Vielleicht kriege ich es raus.
Außer dem uninteressanten Bunker gibt es die Manni. Der Gegenpol zu Bunker. Sie ist liebenswert, sie ist ordinär, sie ist nicht besonders hell, sie ist blond – das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen – und sie ist wichtig in meiner Geschichte über Menschen, die Kunst machen. Kunst machen – das klingt so handwerklich, bodenständig, wo doch Kunst ... Ja, was eigentlich?
Darum dreht sich die Geschichte: Um Menschen, die Kunst machen, die sie lieben, die sie verachten und verspotten, denen sie gleichgültig ist. Der Manni ist sie eher gleichgültig. Sie ist Slampoet. Sie macht ihr Ding und nennt es der Einfachheit halber Kunst. Das ist ein schmückendes Etikett. Auch wenn der Inhalt ordinär, nicht gescheit ... Aber das habe ich ja gerade gesagt.
Und dann gibt es Ruth. Sie ist burschikos, selbstbewusst und sie macht Kunst, ohne sich viel daraus zu machen. Vielleicht ist genau dies das Geheimnis ihrer Wirkung. Sie lebt Kunst – was für ein wunderbarer Castingshow-Jargon. Nun ja, Kunst ist bekanntlich um ihrer selbst willen da, wie der Mensch auch.
Natürlich wird meine Geschichte von mehr Leuten als
den drei Erwähnten bevölkert und sogar von einer Maske. Sie verbirgt Wibbi, die ich in meiner Erzählung nicht so recht zu fassen kriege. Aber das darf doch so sein. Es bleibt immer ein ungeklärter Rest, das große Unbestimmbare, der Joker, der oft nicht sticht – in der Kunst und im Leben.
Die vier habe ich jetzt im Vorgriff vorgestellt, weil sie die private Theatergruppe bilden, die, zusammengehalten von Vadim, dem Künstler, Theaterpädagogen und alterslosen Lockenkopf, die eigentliche Hauptfigur der Erzählung ist. Hier beginnt sie.
Die Neue
Heute sollte sie erstmals dabei sein, die Neue, bei der Probe von Vadims Theatergruppe in ihrem Kulturraum. Es war natürlich nicht ihr Raum. Aber dort wollten sie nächsten Sonntag in Aktion treten, mit szenischen Lesungen und mit Szenen ohne Lesungen. Bunker nahm seinen Hund, Cloud, mit. Er war ein friedlicher Kerl, ein zu groß geratener Collie. Ja, zu groß und deshalb für die Zucht, die Hundeliebe, nicht zugelassen. Der Verband zieht das Handliche vor. Bunker bedauerte seinen Cloud: ein Leben ohne Sex und immer voll schnüffelnder Sehnsucht danach. Cloud, ein Opfer biologischer Gestaltung.
Schon vor Beginn der Probe trieben sich Bunker und Cloud in der Gegend herum. Die bestand vor allem aus dem großen, lang gestreckten Platz vor dem Kulturraum. Dieser Platz war dicht: kleine Geschäfte, Kneipen, manchmal Marktstände, Bäume, riesig, ein Brunnen mit einer stadtbekannten Statue von Buffalo Bill, ein Kiosk, eine Telefonzelle als kostenlose kleine Bücherei. Immer wieder las Bunker die Titel auf den Rückseiten der Bücher. Immer wieder Neues. Jemand hat jetzt sogar einen Nobelpreisträger gestiftet. Ein Franzose, der in Kneipen saß und Buch führte über das Kommen und Gehen der Gäste. Er, der Nobelpreisträger, war total überrascht von der Auszeichnung. Kein Wunder bei dieser Art Literatur. Andererseits: Was ist denn wichtiger als der Mensch, sein Kommen und Gehen? Was machen denn Menschen in Romanen? Sie kommen und gehen, dazwischen erleben sie was, manchmal denken sie auch. Sternschnuppen manche, Blindgänger andere. Er, Bunker, schrieb auch Romane. Daraus hat Vadim Szenen gefiltert, die sie spielen wollten. Zusammen mit der Neuen. Verwaschene Existenzen, pittoreske Existenzen, das war sein Ding. Hier, auf diesem Platz, war auch alles verwaschen und pittoresk zugleich: die heruntergekommenen Plakate, Werbung für allerlei Kulturelles, die alten Sofas und Sessel vor den Kneipen, die Klamotten der Leute, Künstler, Studenten, die ewigen und die voller Hoffnung, die Alkoholiker am Brunnen, die sich gruppieren, sich isolieren, die sich ihren Hunden zuwenden, die vergessen haben, was Hoffnung ist, die dafür kein Konzept mehr haben: für Hoffnung. Leben sie deshalb im Hier und Jetzt, dem viel beschworenen Sehnsuchtsort funktionalisierter bürgerlicher Existenzen? Ein Missverständnis, eine Fundgrube für das Hin und Her von Worten, für Romane, grandios.
Bunker hob den Blick. Die Gerüste der Marktstände wurden abgebaut: Klappern, Knallen, Poltern, Motorengeräusche, Rufen, Schimpfen. – Dazwischen etwas anderes, etwas, das nicht verwaschen war, etwas Leuchtendes, etwas, das kam. Ein roter Mund, ja, das war das Erste, was Bunker wahrnahm. Ein knallroter Mund, nur das. Dann das volle weibliche Gesicht, umrahmt von glattem blondem Haar. Die Gestalt ein wenig stämmig, aber weiblich, sehr weiblich. Der Gang: aufrecht, energisch, die Miene entschlossen. Klar, sie ist die Neue, sie will nicht ganz unten anfangen, sie ist wer, sie weiß es, sie will es zeigen, den Neuen, dem Vadim und seiner Truppe.
Bunker hatte es gewusst und war nun doch überrascht. Die Neue zögerte vor dem Kulturraum, drängte sich an zwei Alkoholikern vorbei, die vor dem Eingang lungerten, betrat den in die Tiefe reichenden Eingangsbereich und stand vor der verschlossenen Tür. Es war noch nicht so weit, aber Bunker kannte die Zahlenkombination für das elektronische Schloss. Er bewegte sich vorbei an den Leuten am Brunnen und näherte sich der Rotmundigen. Neben ihm wedelte Cloud mit der Rute. Die Rotmundige legte den Kopf zurück, presste die Lippen zusammen, blähte ihre Nasenflügel. Sie war gefangen im Eingangsbereich der Kultur. Als der Hund sie fröhlich begrüßte, indem er sich gegen sie drängte wie eine Katze und indem er seinen Wohlfühlsingsang von sich gab, dem niemand wiederstehen kann, entspannte sie sich leicht. Keine Alkoholfahne, ihre Lippen, der Blickfang ihrer Erscheinung, öffneten sich sogar ein wenig, sie lächelte.
Bunker grüßte knapp mit einem Hallo, öffnet den Kulturraum, dirigierte die Neue mit höflichen Gesten in den hinteren Bereich, wo sich die Bühne befindet. Dort endlich spricht er sie an: „Du bist die Neue. Vadim hat dich angekündigt. Wir können ein bisschen Farbe gebrauchen hier. Der ganze Platz kann das gebrauchen.“
„Habt ihr hier überhaupt Publikum? Außer ...“
Sie sprach nicht weiter. Stattdessen machte sie eine Kopfbewegung in Richtung Eingang.
„Außer denen da?“
„‚Denen da‘ kriegen natürlich Freikarten. ‚Denen da‘ kommen trotzdem nicht. Wir zählen ganz auf dich und deine Fangruppe.“
„Ich heiße Manni und ich bin allein.“
„Man nennt mich Bunker und so fühle ich mich auch“, murmelte der Alte.
Manni betrat nun die Bühne und nahm das Mikrofon an sich, das dort in einem Mikrofonständer steckte, natürlich ohne in Betrieb zu sein. Damit ging sie auf und ab, wie zur Erprobung der Bühne und murmelt dabei unverständliche Laute vor sich hin. Ab und zu hörte Bunker heraus: „Männer sind die Renner“. Mehr als diesen Reim konnte er sich nicht aus dem Gemurmle machen. Doch irgendwann stellte sich Manni unvermittelt breitbeinig vor den Mikrofonständer, wurde laut und gestikulierte heftig in Richtung Bunker und Cloud. Was für eine Stimmgewalt. Bunker zuckte zusammen, Cloud, der sich inzwischen hingelegt hatte, sprang auf und schaute mit großen runden Augen, mal in Richtung dieses Stimmereignisses mal zu Bunker, wie um sich zu vergewissern, dass das so in Ordnung geht. Die braucht kein Mikrofon, dachte Bunker, während er zu verstehen versuchte:
Du, du meinst, du bist,
verschwinde doch, verschwinde
in deinem Geilgewinde
in dich selbst gerammt,
verdammt,
da bist du,
bist aus dem Weg,
bist Dreck im Dreck,
bist schweinedicker Mist
verdammt,
du bist ...
Mit dieser Publikumsbeschimpfung ging es noch eine Weile weiter – unter den gebannten und ungläubigen Blicken des ungleichen Duos, welches als Publikum herhielt. Das also war die Neue. Eine Bombe, wie Vadim angekündigt hatte, der sonst immer übertreibt – Theatermensch eben. Diesmal nicht. Diese Bombe wird meine literarischen Texte, die doch auch in Szene gesetzt werden sollten, sprengen. Für Augenblicke fühlte sich Bunker klein und unzulänglich.
Gitarrenklänge, unversehens drangen sie aus dem Hintergrund des Zuschauerraumes. Ruth war still eingetreten, hatte ihr Instrument ausgepackt und begann zu spielen. Ob zur Untermalung von Mannis Texten oder um sie zu stoppen, blieb unklar. Tatsächlich hörte Manni auf. Dabei warf sie wie gekränkt den Kopf in den Nacken. Ruth betrat die Bühne, Manni verzog sich mit kraftvollen Bewegungen und landete neben Bunker, der sie im Ringen um sein literarisches Selbstbewusstsein von der Seite erst bewundernd, dann doch nur einfach staunend ansah. Ruth sang mit leiser Stimme, wobei sie sich immer wieder unterbrach und neu ansetzte. Alles schien doch sehr nur Probe zu sein, ein Experimentieren mit unfertigen, spontanen Texten:
Bist
Ich gewinde mich dir zu,
bin Schwein aus Staub, aus Ton,
bin geil,
bin ich und auch du.
Doch, doch, da bist du schon,
Bist immer da,
Grandios wie Dreck,
ganz unfassbar,
du gehst nicht weg,
bist immer wieder,
wie Staub und Flieder,
wie alte Lieder,
bist wie du und du wie bist,
Schwein gehabt – Mist,
verdammt,
Hauptsache bist.
„Soll das jetzt Satire auf Manni sein, Ruth? Blöd nur, wenn die Satire harmloser ist als das Original. Bei deinen Texten, liebe Manni, bin ich mal gespannt auf deine Fans. Da kommen vielleicht sogar die mit den Geilkarten, nein, Freikarten, die ‚denen da‘, du weißt schon. Meine Meinung dazu: Das ist doch Krampf. Das macht die da“, Bunker deutete auf Ruth, „das macht die da ja aus dem Stegreif besser.“
Ruth sprang Manni bei. „Ihre Texte sind doch selber schon satirisch gemeint. Außerdem ist das endlich mal wilde Kunst aus dem Bauch ...“
„Oder aus noch tiefer“, warf Bunker ein. „Und außerdem: Nicht jeder Krampf kann doch als Satire auf Krampf durchgehen.“
Manni presste ihr Rot zusammen, warf erneut den Kopf in den Nacken und machte Anstalten den Kulturraum zu verlassen.
Da endlich kam Vadim. Er trat der Gekränkten, die den Kopf immer noch sehr hoch hielt, entgegen. Er meinte es ernst, er hielt sie fest, drängte sie mit Körpereinsatz zurück.
„Mit dem gibt’s keine Zusammenarbeit.“ Manni deutete auf Bunker.
„Den da“, Vadim, der Regisseur, deutete auf eben den, „den musst du nicht ernst nehmen. Der ist Banker, Beamter oder so was und pensioniert ist er auch noch. Also, vergiss es. Wir Künstler, Vollblutkünstler, wie du, wir geben ihm Asyl. Er darf auch mal maulen. Ist doch o.k., oder?“
Bunker grinste still in sich hinein. Die Kränkung berührte ihn nicht. Das musste sein, um der Farbe willen.
Plötzlich tauchte eine Gestalt im Hintergrund des Zuschauerraumes auf. Bunker nahm aus den Augenwinkeln einen Schatten wahr. Vadim wandte sich der Gestalt zu.
„Komm her. Was Exterrestrisches fehlt hier noch.“
Die Gestalt folgte dem Zuruf nicht. Sie verschwand, wortlos und ohne sich wirklich gezeigt zu haben. Vadim murmelte so etwas, wie „typisch“ und damit war der Vorgang erledigt.
Nun stand Bunker auf und holte tief Luft. Man spürte, hier würde jetzt gleich so etwas, wie eine Rede gehalten, natürlich eine Grundsatzrede, wie es sich für einen wie Bunker gehört.
„Subkultur, kulturelles Exterritorium, wir, ich, bekennen uns dazu. Aber ...“
Wieder betrat jemand den Zuschauerraum. Er unterbrach Bunker mit seiner Begrüßung: „Wiener, Norbert Wiener. Ich entschuldige mich vielmals. Ich unterbreche ungern eine schöne Ansprache.“
Er machte allerdings keine Anstalten, Bunker das Wort zurückzugeben. Mit gepflegtem Wiener Dialekt fuhr er fort:
„Ich hab es allerdings mehr mit Bildern. Ich bin Künstler und suche nach Ausstellungsräumen. Hier bin ich doch richtig? Ich male Flaschen. Glasflaschen. Transparenz ist mein Credo. Transparenz statt Transzendenz. Alles strebt nach Transparenz. Flaschen mit Geschichte, um die geht es. Am liebsten Pfandflaschen, die alles schon hinter sich haben und auch wieder vor sich. Flasche leer. Ihr kennt das ja.“ Norbert lachte ein wenig und verbeugte sich tief gegen die beiden Frauen und dann, weniger tief, gegen Vadim und Bunker, den er nochmals um Entschuldigung für die Unterbrechung bat. „Flasche leer, leerpfänden, leermalen, das ist meine Berufung, buchstäblich mein Beruf. Ich bin neu in diesem Revier.“
Vadim drückte dem Mann, der neu ist im Revier, das Programmheft des Kulturraums in die Hand und empfahl ihm kurzerhand, sich dort schlauzumachen, wen er ansprechen könnte mit seinem Anliegen. Am nächsten Sonntag könne er im Übrigen gerne der szenischen Lesung hier an diesem Ort beiwohnen, die gerade geprobt werde. Allerdings nicht öffentlich. Norbert verließ den Raum. Manni stand schon wieder auf der Bühne und ließ mit provokantem Blick auf Bunker ihre Hände über die Kurven ihres ein wenig stämmigen Körpers – Bunker fiel dieses Merkmal jetzt sogar ein wenig übertrieben ins Auge – gleiten. Lag das an dem derben Text?
Ich bin keine Insel mit zwei Bergen,
(ihre Hände glitten über ihre Brüste, ziemlich langer Weg),
für eure Windjammer keine Bucht,
(ihre Hände streiften ihre Hüften, noch längerer Weg),
Ich bin eure scharfe Klippe,
(ihre Hände liegen auf den vorgeschobenen
Beckenknochen),
Vernichte euch mit meiner Wucht
(ihre Hände glitten über ihren Hintern)
Beifall aus dem hinteren Teil des Zuschauerraumes unterbrach Manni, die mit der dichterischen Ausbeutung ihrer Körperlichkeit noch nicht fertig zu sein schien. Der Neue im Revier, Norbert Wiener, war wieder da und hatte eine Idee:
„Und jetzt, bitte schön, zur scharfen Klippe noch den atlantischen Tiefseegraben – und bitte auch die Hände dazu.“
„Ich versacke gerade im Tiefseegraben. Lieber Vadim. Das wollte ich ...“
Vadim hörte Bunker nicht zu. Er sah Manni nach, die aus dem Raum gestürmt war. Norbert war ihr schon hinterhergeeilt. Draußen auf dem verwaschenen Platz lautes Rufen, Stimmengewirr, Schimpfen.
Vadim und Ruth eilten nun ebenfalls hinaus. Bunker blieb an der kleinen Bar stehen, die dem Kulturraum den Charme eines Jazzkellers der Nachkriegszeit verlieh. Sein Blick ruhte gedankenlos auf der dahinter aufgebauten Verstärker- und Lichtanlage.
Nicht lange darauf kamen alle zurück. Erhitzt, aber seltsam aufgedreht.
„Bunker, wir haben gerade einen Durchbruch erzielt. Ich musste Manni und Norbert trennen, so sehr waren sie ineinander verkeilt. Am Boden waren sie auch. Eine Menge Leute drum herum. Wir haben behauptet, das sei eine Szene aus deinem Roman ‚Indianerplatz‘, den wir nächsten Sonntag in Szenen vorstellen wollen. Wir kriegen Publikum, großes Publikum.“
Bunker warf Vadim und dann Manni einen Blick unendlicher Herablassung zu und schwieg.
„Du sollst natürlich die Texte von Manni überarbeiten, so ..., redaktionell natürlich nur, auch damit sie zu deinem Roman passen. Sie gehören ja jetzt sozusagen dazu, zu deinem ‚Indianerplatz‘.“
Das synchrone Stöhnen von Manni und Bunker erfüllte den Raum.
ZeitKunst
„Wir können niemanden mehr hereinlassen. Tut uns leid. Feuer- und Flamme-Richtlinien, Fluchtpunktregeln. Wir wiederholen das. Bald. Aber jetzt niemand mehr.“ Vadim musste laut werden. Denn es waren zu viele, die gekommen waren und die in den kleinen Raum drängten. Die Akteure hatten sich im Vorraum gleich hinter dem Eingang versammelt. Sie staunten und grüßten. Manni, die sich eine Wespentaille hingeschnürt hatte, war erkennbar der Blickfang.
Nachdem Vadim den Zustrom gestoppt hatte, schubste Manni Bunker an. Mit rot glänzendem Gesicht sagte sie: „Das hier ist meine Fangruppe, meine.“
„Du hast wohl versäumt, sie vor meinen Texten zu warnen. Danke dafür.“
Der Abend verlief nicht schlecht. Manni war Blickfang – wer sonst. Die Schreckschusspistole, die Vadim ihr beschafft hatte, um ihrer donnernd aufregenden Erscheinung bei einem der Texte noch einen Extradonner mitzugeben, funktionierte nicht. Das war aber schon bei den Proben so gewesen. Und statt eines Donners von der Bühne gab es einen Lacher von den Zuschauern. Das passte zwar gar nicht zu der verworfenen Figur aus dem „Indianerplatz“, die Manni darstellen sollte – aber wen, außer Bunker, kümmerte das schon bei so viel schöner Aufregung.
Die Darbietung war zu Ende, Verbeugungen und Beifall ausgetauscht, da begann etwas Neues. Ein Überraschungsgast betrat das Podest, das die Bühne markierte. Sogar Regisseur Vadim selbst war überrascht von dieser Überraschung. Da stand plötzlich der Mann aus Wien. Er hatte ein großformatiges Bild hinter sich hergeschleppt. Zu sehen war davon nur die Rückseite. Mehrere tiefe Verbeugungen von Norbert wurden mit willigem Applaus quittiert.
„Es muss was geschehen. Aber es darf nichts passieren. Sie kennen vielleicht diese Politikerweisheit aus Österreich, wo ich herkomme. In der Kunst geschieht ständig was. Passieren tut nichts. Das will ich ändern. Es muss radikal etwas passieren.“
Norbert machte eine kleine Pause, hüstelte vor sich hin und verbeugte sich, als sei es das gewesen. Doch dann fuhr er fort:
„Zeit kann man nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken. Proust, der berühmte Autor, hat es versucht. Der Geschmack der Madeleine, das war ihm die verlorene Zeit. Ich hab meine eigene Kunstzeit und Zeitkunst.“
Norbert hustete länger, drehte dann das Bild um. Es zeigte transparente Gegenstände, sicher Flaschen, die ineinander- und übereinandergeschoben waren. Die Bildoberfläche war leicht profiliert. „Es ist kalt hier. Entschuldigung. Ich habe immer einen Wärmestrahler dabei. Ich bin so empfindlich.“ Norbert hüstelte und holte tatsächlich aus dem Zuschauerraum ein Gerät, das er dort offenkundig bereitgestellt hatte. Er schloss es anhaltend hüstelnd ans elektrische Netz an und platzierte es hinter dem Bild. Norbert strahlte.
„Jetzt wird alles gut. Gleich passiert was.“
Aller Augen waren plötzlich gebannt auf das Bild des Norbert Wiener gerichtet.
Die semitransparenten Formen verschwammen, dann rannen Tropfen herunter. Das Bild begann, sich aufzulösen. Das Bild weinte.
„Seht ihr? Hier passiert etwas. Die Kunst weint. Sie weint sich zu Tode. Wollen wir die Zeit anhalten, der Zeit eine Pause geben? Jetzt? Etwas später?“
„Pause“, schallte es mehrfach aus dem Publikum. „Pause.“ Norbert lachte. „Also gut, Pause.“ Norbert machte sich am Gerät zu schaffen. „Ich finde den Schalter nicht. Ist ein neues Gerät.“ Dann beschäftigte er sich mit dem Stecker. „Der will mir nicht gehorchen. Er ist verklemmt“, rief er aus geduckter Haltung. Mit schweißglänzendem Gesicht stand Norbert endlich wieder vor dem Publikum. „Ich glaube, den Stecker der Zeit kann man nicht ziehen. Er ist verklemmt. Die Zeit passiert. Manchmal schmeckt sie nach Madeleine, manchmal sieht sie aus wie Pfandflaschen, jedenfalls für mich – ich liebe leere Pfandflaschen –, manchmal weint sie bloß, weil sie nur aus Wachs gemacht ist, manchmal ...“
Wieder verbeugte er sich. Das Bild war inzwischen zerronnen. Norbert schaltete das Gerät aus und kehrte unter großem Applaus und auch Jubel auf seinen Platz im Publikum zurück.
Manni und Wibbi
Der Abend im Kulturraum war vorüber, man trank noch in der benachbarten Kneipe, prostete Manni zu, prostete Norbert zu, prostete überhaupt sehr viel, hörte sich die Kritik von Bunker an Manni an und machte sich dann auf den Heimweg. Alle wohnten irgendwo in der Gegend, die räumlich von diesem Platz, geistig vom Geschehen im Kulturraum geprägt war – alle außer Manni. Sie wohnte auswärts. Ihr bot Vadim deshalb an, die Nacht in seiner kleinen Wohngemeinschaft zu verbringen, wo sich leicht ein Schlafplatz würde finden lassen. Die Eingeladene nahm an. Bunker verabschiedete sich von ihr mit der Bemerkung, bei eingeschnürter Taille leide bekanntlich die Durchblutung des Kopfes, daher die vielen weiblichen Ohnmachten in der Zeit des Rokoko. Das mache aber bei ihr nichts, da sie ja mit einem anderen Körperteil als dem Kopf texte. Manni stampfte wütend davon und folgte Vadim.
Es begab sich also ... Diese Formulierung ist hier durchaus angebracht, ja sie kommt hier zu ihrem vollen Recht, denn es war eine Schicksalsfügung, zumindest eine temporäre, aus dem Dunkel des Zufalls heraus und andere gibt es ja sowieso nicht. Es begab sich also, dass Manni auf Wibbi traf, mit der Vadim die Wohnung teilte. Wibbi gehörte zu Vadim wie ein abgelegtes Kleidungsstück, das man aus gefühliger Rücksichtnahme gegen die eigene Vergangenheit im Kleiderschrank hängen lässt statt es der Altkleidersammlung anzuvertrauen.
Manni und Wibbi, von Vadim gelegentlich auch Whisky genannt, verstanden sich auf Anhieb. Wie soll ich das beschreiben? Manni befand sich im Zustand höchster Kränkung – mal wieder. Sie war trotzig entschlossen, sich und ihre Krampfkunst – ich gebe zu, dass ich in diesem Punkt Partei bin – von diesem verkrampften – da bin ich durchaus auch ganz bei ihr – Bunker nicht unterkriegen zu lassen. Sich selbst inszenieren, so wie sie war, authentisch eben, darum ging es. Und Wibbi? Die lebt ... die entgleitet, auch mir. Also sag ich mal: Sie lebte – mit allem, was dazugehört, mit Trotz, mit Langeweile, mit Ressentiments, ja, ich glaube, Ressentiments waren wichtig, bestimmte gegen Männer, vor allem solche, mit denen sie „es hatte“, unbestimmte gegen den Rest der Wirklichkeit, gegen sich selbst wahrscheinlich auch. Ein Hang zu existenzialistischem Fundamentalismus war ihr eigen. Oder war es Bodenlosigkeit? Oder sind die am Ende verschwistert, sozusagen als fundamentale Bodenlosigkeit? Jedenfalls war Alkohol eine ihrer Existenzialien. Das Absolute, der freie Fall, arroganter Trotz gegen das Leben, darin schien sie sich eingerichtet zu haben. Mit aller Konsequenz, nämlich einem Selbstmordversuch.
Mehr kann ich zur Begründung dieses Versuchs nicht sagen. Die Versuchsanordnung war überaus sorgfältig gestaltet gewesen. Niemand konnte ihr nachsagen, der Versuch sei nur der Hilferuf einer verlorenen Seele gewesen, also nicht wirklich ernst gemeint. Er war dreifach abgesichert: Mit einer Überdosis Schlaftabletten, einer vollen Flasche Whisky und einer Zigarette im Mund hatte sie sich zu Bett gelegt. Aber das Vorhaben scheiterte. Das geplante, von der Zigarette aber zu früh entfachte Feuer schmerzte, der Whisky hatte noch nicht die notwendige Schmerzbetäubung bewirkt, vegetative Selbsterhaltungsreflexe übernahmen die Herrschaft und Wibbi schleppte sich, von den Schlaftabletten halb betäubt zur Zimmertür. Vadim veranlasste das Erforderliche, um seine in dem Raum aufgehängten Kunstwerke, Möbel und auch Whisky zu retten. Die Rettung von Whisky gelang nur unvollständig. Die rechte Gesichtshälfte blieb dauerhaft von schweren Brandspuren gezeichnet. Sie war, was dem ganzen Körper hätte zuteilwerden sollen: tot. Wibbi arrangierte sich mit diesem zweifelhaften Teilerfolg.
Der arrogante Trotz gegen das Leben Wibbis traf also auf den momentan entfachten – aber eben doch als Komplement eines aufbrausenden Wesens zur Wiederholung tendierenden – Trotz Mannis. Und es funkte.
Vadim hatte auf eine Vorstellung der beiden verzichtet. Macht das am besten selber, hatte er gemurmelt, bevor er sich verzog. Und so war die Manni erstmal beeindruckt von der Maske der Frau, die ungerührt auf einem Zweiersofa saß und die auch keine Anstalten machte, auf den Gast zuzugehen. Ja, Wibbi verbarg ihr Gesicht hinter einer Maske, die sie mit zwei Bändern vor ihr Gesicht geheftet hatte. Sie brachte das asymmetrisch ruinierte Aussehen ihres Gesichts ins Gleichgewicht, indem sie dafür sorgte, dass sich beide Gesichtshälften gleich tot präsentierten. Wibbi trug diese goldfarbene Maske mit den schmalen Augenschlitzen, der flachen Nase mit den kleinen Luftlöchern und der zierlichen Mundöffnung mit herablassendem Stolz gegen den Rest der Menschheit und zugleich in tiefem Trotz gegen ihre eigene Eitelkeit, die ehemals in ihrer herausragenden Schönheit reichlich Nahrung gefunden hatte.
Leicht verunsichert sprudelte Manni nach kurzem Zögern los, während sie auf die Maske deutete: „So ist mir auch zumute. Vor allem, wenn ich diesen Typen sehe, den Bunker. Hinter einer Maske verschwinden und fertig. Kennst du den? Tut cool, hält sich selber für enorm gescheit. Blödmann.“
„Natürlich kenn ich den. Den gibt’s in millionenfacher Ausfertigung.“
„Wie oft gibt’s deine Maske? So was will ich auch.“
Manni warf sich neben Wibbi auf das Zweiersofa. Die Maske ließ sie nun nicht etwa fremdeln, sondern schuf nach erster Verunsicherung ein Gefühl der Unbekümmertheit – als seien sie zusammen allein.
Wibbis Maske wendete sich der in Körperkontaktnähe herangerückten Nachbarin zu. „Das kriegt man nur nach einem Initiationsritual.“
Die Manni sah Wibbi irritiert an.
„Du musst durchs Feuer gehen. – So wie ich. Du musst sie dann aber auch immer tragen, wie ich. Die Leute denken, ich inszeniere mich. Ist mir recht.“
„Du willst dich abschotten. Stimmt’s? Ich versteh das gut. Ich versteh das.“
„Hat der ...“, Wibbi deutete auf die Tür, hinter der Vadim verschwunden war, „nichts erzählt?“
Manni sah Wibbi groß an.
„Seine angebliche Heldentat. Er hat mich gerettet, der Held. Das behauptet er. Ich weiß es anders. Ich war ja dabei bei der Rettung. Nicht ganz bei mir. Aber doch dabei. Ich hause seither als nachhaltiger Kollateralschaden in der Wohnung hier und natürlich in seinem verdammten Leben.“
Wibbi erzählte ihre Version des gescheiterten Selbstmordes.
Die Manni wusste nicht, was sie sagen sollte. Vadim hatte sie schon gewarnt. Wibbi ist seltsam, hat er gesagt. Sonst nichts. Sie hatte das als Männergeschwätz abgetan. Und jetzt? Sie fühlte sich wohl neben der Maske. Waren nicht alle anderen Menschen seltsam? Die anderen, die nur so taten, als hätten sie keine Maske auf, so wie der blöde Bunker. Dabei gibt’s doch so was wie ‚keine Maske‘ gar nicht. Also war es ehrlich, erkennbar eine Maske zu tragen. Es war authentisch. Einfach anders.“
„Ich werde mir jedenfalls auch so eine Maske zulegen. Dann muss ich den doofen Bunker nicht mehr sehen.“
„Dann sieht er erst mal dich nicht“, klärte Wibbi auf.
„Das ist doch das Gleiche“, beharrte Manni. „Wenn er mich nicht sieht, dann ist das, als wär ich nicht da. Und wenn ich ‚als wär ich nicht da‘ bin, dann ist das, als würde ich ihn nicht sehen. Also ist es das Gleiche.“
„Das ist nur ‚als ob es das Gleiche wäre‘.“
Manni glaubte, ein Lächeln wahrzunehmen. Das Als-ob-Lächeln einer Maske. Sie sah es förmlich, sie war sich ganz sicher. Sie hatte etwas Gescheites gesagt. Bestimmt. Sie, die von dem blöden Bunker immer so abgekanzelt wird ..., als ob, ja, als ob sie eine Hilfsschülerin wäre, jawohl. Deshalb sah sie ein Lächeln, ein authentisches, maskenhaftes Lächeln. Ja, neben einem Maskenmenschen zu sein, machte sie frei. Manni fühlte es so und sie genoss es.
Die lächelnde Maske stand auf, hantierte kurz an einem Computer und verschwand wortlos im Flur. Die Tür schloss sie nicht. Manni blieb einigermaßen verdutzt zurück. Dann konzentrierte sie sich auf die Stimme aus dem Computer. Es war eine schöne, sonore weibliche Stimme, die da vortrug:
Die großflächige Abstraktion dieses Bildes enthüllt bei naher Betrachtung eine weite, intensive Dürre, die dem geduldigen Betrachter als Landschaft entgegentreten mag. Konsequenter Verzicht auf explizite Zeichen, auf Gegenständliches innerhalb des Abstrakten, die nahezu schmerzhafte Insistenz auf Leere prägen dieses Bild. Gerade durch diese schöpferische Verweigerung wird das Bild zum Gefäß, das den Schöpfungsakt, dem es sich verdankt, im besten Sinne des Wortes aufhebt. Das ihn also vor der Vergängnis bewahrt und das ihn zugleich auf eine höhere Ebene hebt: auf die Ebene schöpferischer Interaktion oder besser interaktiver Schöpfung von Künstler und Kunstbetrachter. So wird dieses Bild zur Chiffre für ein äußerstes Humanum, in dem der Schöpfungsakt, die Kunst selbst dialektisch untergehen muss und untergehen darf.