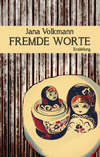Loe raamatut: «Das Zeichen für Regen»

Jana Volkmann
DAS ZEICHEN
FÜR REGEN
Roman

In Kyōto bin ich
doch beim Schrei des Kuckucks
sehn ich mich nach Kyōto
Bashō
1. TEIL
1. Kyōto. Vor einem Jahr.
Wenn man auf dem Kansai International Airport landet, fühlt sich das an, als fiele man ins Meer. Der Flughafen ist auf eine künstliche Insel gebaut, fünf Kilometer liegen zwischen den Terminals und dem Festland. Die Schiffe in der Bucht von Ōsaka, über die man hinwegfliegt, sehen gefährlich groß aus. Bootsführer drehen sich um, wenn über ihren Scheiteln eine Passagiermaschine im Sinkflug Richtung Boden braust, und sie wirken ein wenig entsetzt, jedenfalls sieht es danach aus, wenn man im Flugzeug sitzt und selbst ein wenig entsetzt ist.
Irene erinnerte sich gut an das Gefühl beim Anflug, an den Schrecken und an die Angst vor dem Meer, an die Farbe des Wassers in der Bucht und an das Rumpeln der Tragflächen. Sie war zuvor nicht oft geflogen. Ihre Finger hielten sich an der Lehne fest. Die Landebahn bemerkte sie erst, als der Flieger aufsetzte. Ihr zweites Leben begann in dem Augenblick, als die Räder der Boeing 777 auf Asphalt trafen, die Maschine einen Ruck nach vorn machte und ihr klar wurde, dass sie schon an Land war, dass sie nicht ins Wasser stürzen und nicht ertrinken würde. Das war vor einem Jahr.
Auf dem Weg vom Gate bis zu ihrem Koffer musste sie einen Shuttlezug nehmen. Sie lief hinter den anderen Passagieren her, obwohl sie keine Ahnung hatte, ob diese den Weg kannten. Sie stellte sich hinter sie in die Schlange vor den Türen, drängte sich zu ihnen in den Zug, lief hinter ihnen her über Treppenstufen, Rollbänder, durch lange und kurze Gänge. Als sie schließlich mit den anderen Fluggästen am Gepäckband angelangt war, hatte sie gerade Gefallen daran gefunden, durch das Gebäude zu irren.
Erst als sie ihren Koffer wiederbekommen hatte, den Pass mit ihrem Visum vorgezeigt hatte und die anderen Fluggäste verschwunden waren, als hätte es sie nie gegeben, da erst fühlte sie sich ein wenig allein. Sie fühlte sich immer noch allein, als sie im Zug nach Kyōto saß, am Bahnhof fühlte sie sich allein, in der U-Bahn. Und als sie ihre neue Wohnung aufschloss, merkte sie, dass das genau die Art von Alleinsein war, die sie sich gewünscht hatte.
Sie stellte den Koffer ab und ließ sich auf das Bett fallen. Die Decke und das Kissen rochen noch ganz neu, ein wenig nach Plastikfolie. Auf der Bettwäsche zeichneten sich Falten in einem rechteckigen Muster ab. Die Vermieterin hatte sich offenbar nicht die Mühe gemacht, das Bettzeug zu waschen, aber Irene war das nicht wichtig. Je weniger Arbeit man sich mit ihr machte, desto wohler fühlte sie sich. Sie würde das Bettzeug einfach am nächsten Tag selbst waschen. Irene lächelte und lag mit offenen Augen wach, bis es dunkel wurde.
Die Sonne ging in Kyōto viel eher unter als in Berlin, das war das erste, was sie über ihre neue Heimat lernte. Zuvor hatte sie nur gelesen. Dass der Kansai International Airport mitsamt seiner künstlichen Insel im Jahr fast fünf Zentimeter tiefer ins Meer sinkt, zum Beispiel. Und dass die Gebäude mitsamt der Treibstoffversorgung deshalb so angelegt sind, dass sie sich an diesen Höhenunterschied anpassen. Irene hatte im Flugzeug darüber nachgedacht, wie das gehen soll, und war zu keinem Ergebnis gekommen.
Ihr Bett stand direkt unter dem Fenster. Sonst gab es hier nicht viel: einen Esstisch, der kleiner war als alle, die sie zuvor gesehen hatte. Eine Küchenzeile, die auch nicht eben groß war, und einen Schrank, in den sie in den kommenden Tagen ihre Kleidung einräumen würde, aber das eilte nicht. Irene setzte sich auf und stützte sich mit den Ellbogen auf die Fensterbank. Sie hatte auch gelesen, dass Kyōto, außer im Süden, von Bergen gesäumt war, aber sie hatte sich nicht vorstellen können, dass sie diese Berge jemals aus ihrem eigenen Fenster in ihrer eigenen Wohnung sehen würde. Sie schaute der Sonne beim Verschwinden zu und sah, wie die Gipfel im Zwielicht in den Himmel hineinflossen, bis sie nicht mehr davon zu unterscheiden waren, dann wurde sie müde.
Sie schlief fest, weit in den nächsten Morgen hinein. Von der Zeitverschiebung spürte sie nichts, und als sie in der Frühe zum Getränkeautomaten an der nächsten Straßenecke ging, kam es ihr gar nicht so vor, als liefe sie den Weg zum ersten Mal. Sie entschied sich für eine Zitronenlimonade, ohne lange nachzudenken, und fand ihre Wahl gut. Sie wollte nicht gleich zurück in die Wohnung, und da sie nichts weiter zu tun hatte, lief sie durch ihre Nachbarschaft und kaufte sich ein paar dango zum Frühstück – kleine gegrillte Reisklöße auf einem Holzspieß. Man musste gar nicht sprechen, um sich zu verständigen. Sie zeigte auf die Spieße, hielt drei Finger hoch und gab einfach viel zu viel Geld, sodass sie in jedem Fall etwas wiederbekäme und das Rechnen in fremden Zahlen der Verkäuferin überlassen konnte. Es schmeckte andersartig und gut, ein wenig süß. Der Reis klebte ihr zwischen den Zähnen. Sie blieb hin und wieder vor Restaurants oder Geschäften stehen, versuchte Speisekarten und Preislisten zu entziffern und ließ sich im Rhythmus der Stadt umhertreiben, im Rhythmus der blinkenden Leuchtreklamen und des Strampelns der Radfahrer, der stöckelnden Schritte der Frauen und Mädchen, die auf hohen Absätzen aus Cafés kamen oder aus Bussen stiegen.
Überhaupt fand sie ihre Wege in diesen ersten Tagen in Kyōto mit einer Sicherheit, die sie bei ihren Umzügen innerhalb Deutschlands nie gehabt hatte. Den Weg zur Post, zum Supermarkt, zur U-Bahn-Station: Sie brauchte sich nur aus dem Haus zu bewegen und loszulaufen. An die Wand neben ihrem Bett hängte sie einen Stadtplan und prägte sich die Straßen ein. Die Stadt erschien ihr außergewöhnlich symmetrisch, die meisten Wege waren im Schachbrettmuster angelegt. Wie New York, dachte Irene, und der Gedanke hatte etwas seltsam Tröstliches – zu wissen, dass auf ganz anderen Erdteilen ganz andere Städte lagen, durch deren Straßen ganz andere Leute liefen und dass sie dennoch mit einer Wahrscheinlichkeit von überwältigenden fünfundzwanzig Prozent in dieselbe Himmelsrichtung liefen wie sie.
Sie vermisste nichts und staunte nicht übermäßig über alles, was in Kyōto anders war. Weder über die Zebrastreifen, mit denen man große Kreuzungen diagonal überqueren konnte, noch über die vielen Fahrräder. Auch nicht über den Linksverkehr oder die Kinder in Schuluniformen. Es war, als fänden die Wege sie und als fände Japan sich in ihr zurecht, nicht umgekehrt. Jedenfalls kam es ihr heute so vor, wenn sie an die Tage nach ihrer Ankunft dachte. Sie wusste, dass sie sich viel fremder hätte fühlen müssen, dass es nur natürlich gewesen wäre, wenn sie inmitten der Straßenschluchten und der Autos, die links und rechts an ihr vorüberzogen, die Orientierung verloren hätte. Stattdessen fühlte sie sich, als habe sie die Stadt bereits gekannt, lange ehe sie dort angekommen war. Ein eigenartiges Gefühl des Erinnerns begleitete sie durch diese ersten Tage.
2. Kyōto. Heute.
Irene schob den Wagen mit dem Bettzeug, den frischen Handtüchern und all dem Putzmittel über den Teppich auf dem Flur. Es erschien ihr unsinnig, hier einen so weichen Teppich zu verlegen, aber es erschien ihr sowieso vieles unsinnig an ihrem Job, also dachte sie nicht weiter darüber nach.
Die Anstellung als Zimmermädchen hatte sie über einen Freund bekommen. Timo war Japanologe und hatte ihr von Berlin aus Kontakte nach Kyōto vermittelt, er kannte jemanden im Hotel Kikka, irgendwen im Personalmanagement. Er hatte ein paar Anrufe gemacht und ein Empfehlungsschreiben aufgesetzt. Irene war es unangenehm gewesen, dass er sich so hatte ins Zeug legen müssen, aber es war ihre einzige Chance gewesen, ohne größere Schwierigkeiten nach Japan zu gelangen. Er hingegen hatte sich ein wenig geschämt, ihr nichts Besseres bieten zu können, und gemeint, wenn sie erst mal selbst vor Ort wäre, könnte sie sich ja gleich nach etwas Besserem umsehen. Für ein paar Monate sei es sicher ganz in Ordnung. Nun waren es schon zwölf Monate, die sie hier arbeitete. Irene konnte sich gar nichts anderes mehr vorstellen. Ihr Studium war noch nicht lange vorbei, aber es erschien ihr wie ein anderes, altes Leben. Wie sich das damals angefühlt hatte, im Seminar zu sitzen oder im Hörsaal, in die Bibliothek zu gehen, daran erinnerte sie sich kaum. Überhaupt dachte sie selten an Deutschland.
Die Zimmer waren alle gleich geschnitten, mit ein paar wenigen Variationen bei der Größe der Betten; in den Bädern lagen immer die gleichen kleinen Kästchen mit Haarbändern, Zahnbürsten und Kosmetika, die es aufzufüllen galt. Die Arbeit im Hotel war nicht unbedingt einfach, aber wenn man erst mal den Dreh raus und eine gewisse Routine entwickelt hatte, machte sie sich trotzdem fast von allein. Nach einer Weile überließ sie die Arbeiten ganz ihrem Körper, in dessen Gedächtnis sich die Bewegungen so sehr eingeprägt hatten, dass Irene sich mehr oder weniger heraushalten konnte.
Manchmal, wenn ihr langweilig war, überlegte sie sich Geschichten über amouröse Verstrickungen zwischen den Hotelgästen, so dass daraus eine kleine Seifenoper nur für sie selbst wurde. Bei jeder Schicht erzählte sie sich die neuste Folge. Der Mann in 1331 hatte in ihrer Vorstellung nicht ohne Grund ein Zimmer für zwei gebucht. Die Frau aus 1204, die so unglücklich aussah, als sie sie auf dem Flur grüßte, schlief nämlich in Wahrheit gar nicht in 1204. Der Mann aus 1204 bekam in Irenes Seifenoper nichts davon mit, weil er jeden Abend den teuersten Whiskey aus der Minibar trank und selig schlief, während seine Frau mit dem Geschäftsmann ein romantisches Date im dreizehnten Stock hatte. Frau 1204 und Herr 1331 blickten Arm in Arm aus dem Fenster auf die Stadt, betrachteten den eigentlich nicht sehr ansehnlichen Kyōto Tower und die Berge in der Ferne. Dann sahen sie einander lang und intensiv in die Augen, ehe Frau 1204 wieder zurück in den zwölften Stock musste, zurück zu ihrem unerträglichen Mann.
Oder sie stellte sich vor, dass die Musik auf den Fluren nicht aus Lautsprecherboxen kam, sondern dass ein winziges Orchester direkt unter der Decke saß und Vivaldi oder Beethoven spielte. In letzter Zeit hatte sie angefangen, hin und wieder den Lautsprechern in der Decke zuzuzwinkern, wenn sie den Rollwagen über den Flur schob. Sie dachte dann an Kafkas Josefine, die kleine Mäusesängerin, und sehnte sich ein wenig nach ihrem Bücherschrank, den es nun nicht mehr gab. Sie hatte kein einziges Buch mit nach Japan genommen.
Die thailändischen Zimmermädchen sprachen thailändisch miteinander, die Indonesierinnen indonesisch und die Philippinerinnen Tagalog. Die einzige Brasilianerin sprach mehr oder weniger mit niemandem, so wie Irene. Aber aus all dem Sprachgewirr hoben sich immer wieder japanische Worte ab, die Irene teils verstand, teils einfach aufgrund ihres Klangs als Japanisch erkannte. Außer ihr konnten alle gut genug nihongo, um sich ausgiebig auszutauschen, und es gab viele japanische Zimmermädchen. Sie hatten ihr zu Anfang beigebracht, sich zu verbeugen und den Hotelgästen freundlich zu danken, obwohl ihr nie ganz klar war, wofür, denn die meisten Hotelgäste hinterließen die Zimmer in einem Zustand, der nicht besonders dankenswert war. Ihre Sprachkenntnisse reichten aus, um die Wünsche der Gäste entgegennehmen und erfüllen zu können, aber ihre eigentliche Aufgabe war, Wünsche zu erfüllen, bevor sie geäußert wurden. Die meiste Zeit wischte sie Staub, wechselte Laken und putzte Bäder. So gern sie ihr Alleinsein mochte, manchmal hätte sie gern besser Japanisch gesprochen. Nicht unbedingt um sich an den Unterhaltungen um sie herum zu beteiligen, eher um sie zu verstehen. Sie war sicher, dass die anderen Zimmermädchen einander alles erzählten, was sie bei der Arbeit erlebten. Wenn sie Sexspielzeug in den Zimmern gefunden hatten, zum Beispiel. Wenn jemand ein besonders großzügiges Trinkgeld gab. Wenn alles danach aussah, als habe sich eine ganze Familie in einem Einzelzimmer einquartiert, vom Baby bis zur Großmutter. Wenn ein männlicher Gast eine ganze Kollektion von Pumps in großen Größen im Vorraum drapierte. Wenn einer wie George Clooney aussah, oder wie der japanische Premierminister, dessen Namen Irene einfach nicht behalten konnte. Sie versuchte, alle wichtigen Namen auswendig zu lernen. Die von ihren Kolleginnen und von den Portiers, natürlich die ihrer Vorgesetzten, und in dieser Liste wichtiger Personen war irgendwie auch der Premier gelandet, obwohl er dort nicht wirklich etwas verloren hatte.
Wäre in dem Jahr, das sie nun hier in Kyōto verbracht hatte, ein neuer Premierminister gewählt worden, hätte sie das vielleicht gar nicht mitbekommen. In Japan wurde häufig neu gewählt. Wegen der Rücktritte, die wiederum oft wegen Korruptionsaffären zustande kamen. Vielleicht versuchte sie schon seit Monaten, sich einen Namen einzuprägen, der gar nicht mehr aktuell war. Es kam vor, dass Irene auch über solche Dinge nachdachte, während sie Bettlakenzipfel unter Matratzen packte, Fernsehschirme abwischte oder Toilettenbrillen desinfizierte. Es störte sie nicht, dass ihr die aktuelle politische Lage derart unklar war.
Wenn sie gewollt hätte, hätte sie jederzeit nachsehen können, wer gerade welches Amt bekleidete, sie hätte sich einen schnellen Überblick über die Parteien und ihre Vertreter machen und dieses Wissen mit halbwegs wenig Aufwand auf dem neusten Stand halten können. Sie war nie besonders interessiert an solchen Dingen gewesen und konnte, wenn sie ehrlich war, auch das deutsche Kabinett nicht herunterbeten. Aber dieser blinde Fleck, der alles Aktuelle, alles Relevante, die ganze Gesamtgesellschaft aus ihrer Wahrnehmung strich, ließ sich nicht darauf zurückführen, dass sie nicht wusste, wo es am Bahnhof internationale Zeitungen zu kaufen gab. Die englischsprachige Ausgabe der Asahi Shimbun, USA Today, der Guardian, selbst die Süddeutsche: Auf ihrem Heimweg kam sie jedes Mal an zig Läden vorbei, in denen sie sich mit Zeitungen eindecken könnte, die sie verstehen würde. Sie fegte noch dazu an jedem Arbeitstag zig Zeitungen in die Hotelpapierkörbe, unbesehen, unaufgeschlagen, mit der gleichen lässigen Wischbewegung wie für leere Starbucks-Becher, gebrauchte Taschentücher und Nigiri-Verpackungen. Die russische Vogue, wisch und weg. Danke und auf Wiedersehen, Zeit-Magazin. Sayōnara, New Economist. Die ganze internationale Presse wanderte hier Tag für Tag in den Müll. Irene fühlte fast so etwas wie Erleichterung dabei. Hier durfte sie sich ein ganzes Universum nach ihren eigenen Maßstäben zusammenstellen, und niemand könnte ihr einen Vorwurf daraus stricken, dass sie sich nicht um politische Themen, aktuelle Themen und alle möglichen anderen Themen scherte. Weil sie ja auch mit niemandem darüber sprach und niemand auf die Idee kam, sie nach einer Meinung zu irgendwas außer dem Wetter zu fragen. Manches war wesentlich einfacher geworden, seit sie hier in Japan war.
Die meisten Gespräche, die Irene führte, beschränkten sich auf höfliche Floskeln, von denen sie sich nie ganz sicher sein konnte, ob sie wirklich angemessen waren. Es gab so vieles zu beachten, und noch immer kämpfte sie mit den Silben. Bei der Arbeit brauchte sie zum Glück nicht viel zu sprechen. Irasshaimase, arigatō gozaimashita, wakarimasen. Doitsujin desu, sagte sie manchmal, ich bin Deutsche. Wie eine Entschuldigung. Dann sagte ihr Gegenüber meist etwas, das wie »achso« klang und genau dasselbe bedeutete, und in diesen Momenten wäre sie gern anderswo gewesen, wo sie dieselbe Sprache sprach wie alle und andere Leute ohne Mühe verstand. Aber wenn sie dann, die Arbeitskleidung gegen Jeans und T-Shirt getauscht, das Hotel Kikka hinter sich ließ und in ihr neues Leben hineinlief, dann war sie wieder ganz sicher, dass sie hier richtig war.
Bevor sie in Ōsaka gelandet war, hatte sie Japan nur aus ihren Büchern gekannt. Sie hatte sich in Banana Yoshimotos Tsugumi und in Yōko Tawada verliebt, viele Stunden versucht, Haruki Murakamis rätselhafte Romanfiguren zu entschlüsseln und hinter das Geheimnis ihrer Ohren zu kommen, hatte dank eines Romans von Yōko Ogawa mit dem Schachspielen begonnen (und es bald darauf wieder bleiben lassen, hauptsächlich weil niemand gegen sie antreten wollte), und sie war mithilfe von Ryūnosuke Akutagawas Kurzgeschichten durch die Vergangenheit ihres Wunschortes gereist. Damals hatte sie nicht für möglich gehalten, dass es dieses Japan tatsächlich geben könnte, jedenfalls nicht so, wie es in ihrer Vorstellung existierte. Sie hatte gedacht, sie könne sich dem richtigen, tatsächlichen Japan bestenfalls mit Mäuseschritten nähern. Nur um jedes Mal, wenn sie etwas Neues über das Land und das Leben dort lernte, zu begreifen, wie unzureichend ihre Vorstellung war.
Die japanischen Romane hatte sie bei ihrer Abreise an ein Antiquariat verschenkt, und viele andere Bücher auch. Manche konnte sie verkaufen, nicht so, dass sie davon reich geworden wäre, aber immerhin. Timo überließ sie alle, die er haben wollte; einen anderen Stapel Bücher packte sie in einen Pappkarton, mit dem Vermerk, dass sie zum Mitnehmen seien. Die Rücken nach oben, so dass man die Titel sehen konnte. Sie stellte sie einfach an die Straße, auf die oberste Stufe der Treppe, die zu ihrer Haustür führte. Sie standen nicht lange dort. Selbst die Kiste fehlte, als Irene beim nächsten Mal das Haus verließ.
Die Bücher blieben in Berlin. Irene ging alleine fort, ohne Andenken, ohne Wehmut und Bange. Sie hatte immer schon fort gewollt, nur dass dieses Gefühl über die Jahre immer festere Formen angenommen hatte, immer drängender geworden war. Für sie war der Schritt nach Japan ein ganz logischer, auch wenn kaum jemand ihre Entscheidung nachvollziehen konnte. Sie konnte sich dort nicht fremder vorkommen als in Berlin.
3. Berlin. Früher.
Irene lag auf dem Rücken, die Hände ruhten auf ihrem Bauch. Sie war erleichtert, dass er so bald nach dem Sex eingeschlafen war, aber Irene selbst war danach umso wacher, ihr Körper umso unruhiger gewesen. An Schlaf war nicht zu denken. Nicht mit diesem Mann neben ihr, nicht in dieser Luft, die so verbraucht roch, nach ihnen beiden, nach der Nacht, die noch nicht vorbei war. Am liebsten hätte sie das Fenster geöffnet, aber sie mochte ihn unter keinen Umständen wecken. Draußen war es sicher laut. Er wohnte an der Gneisenaustraße, im Vorderhaus, erste oder zweite Etage. Da war immer Verkehr, und um diese Zeit würden genug Leute auf dem Heimweg sein, die nach dem letzten Bier keine Ahnung mehr hatten, wie laut sie sich unterhielten. Würde der Mann jetzt wach werden, würde er sie berühren, vielleicht sogar noch mal mit ihr schlafen wollen. Oder er würde sie in die Arme nehmen, in ihren Nacken atmen und seinen Bauch an ihren Rücken drücken. Manche wollten das. Irene ließ das Fenster geschlossen. Sie hatte sich an die Dunkelheit gewöhnt und sah den Stuck an der Decke an, bis das Muster vor ihren Augen verschwamm.
Der Mann hieß Carsten, aber es war Irene lieber, nicht an seinen Namen zu denken, sondern einfach an den Mann, ein unbestimmter Mann mit einem bestimmten Artikel. Er sah allerdings eher aus wie ein alter Junge, wie er da grauhaarig und mit Stoppelbart unter seiner Decke lag. Das Muster der Bettwäsche war ausgeblichen.
Irene stellte sich vor, wie er in seinem Elternhaus in derselben Bettwäsche geschlafen hatte, vielleicht in einem Dachzimmer mit Konzertplakaten von Bands an einer vertäfelten Wand, nur dass die Bands damals wahrscheinlich Gruppen hießen. Vielleicht hatte er selbst in einer Gruppe gespielt, Bass oder Schlagzeug. Kein Gesang, keine Gitarre, das passte nicht. Der Bass passte. Wahrscheinlich war er ein cooler Junge gewesen, nachdenklich und interessant, rebellisch, unbeirrt, ein wenig zu ernst vielleicht, vielleicht zu wütend. So einer, von dem man nie angenommen hätte, dass sein Leben irgendwann so traurig werden würde, dass er Mädchen wie Irene mit in seine Wohnung nehmen musste und ihnen verlegen erklärte, die Bilder an der Wand habe seine Nichte gemalt. Dabei hätte Irene nie um eine Erklärung gebeten. Sie wollte gar nicht wissen, wessen Kind das war, das diese Häuser und Schmetterlinge gemalt hatte. Als gingen sie einander irgendetwas an.
Den Mann hatte sie ein paar Tage zuvor im Café getroffen. Das passierte Irene selten, eigentlich war es so gut wie nie vorgekommen, dass sie einfach so angesprochen wurde. Sie sah nicht übel aus, achtete auf ihren Körper, kleidete sich nicht gerade auffällig, aber mit den Jahren hatte sie so etwas wie einen eigenen Stil entwickelt, der einem etwas kritischen, kennenden Blick durchaus eine Weile standhalten konnte. Aber irgendetwas schien nicht zu stimmen mit ihr.
Stattdessen suchte sie ihre Dates oft über das Internet, schrieb Männer an, ließ sich anschreiben, antwortete und wartete auf Antworten. Das konnte sie, sie schrieb gut, lockte mit Worten, machte sie neugierig mit drei, vier Sätzen. Es funktionierte. Wenn sie schrieb, war sie interessant. Vermutlich schien sie dann klüger, als sie war. Sprechen lag ihr weniger. Sie wirkte oft spröde auf Fremde, wie eine, bei der es viel Mühe kosten würde, ihr nahezukommen, und bei der man nie sicher war, ob sich diese Mühe lohnen würde.
Einer, der ihr wichtig war, hatte ihr einmal gesagt, sie sehe aus wie jemand, der andere traurig macht. Den Satz vergaß sie nicht, sie war überzeugt, dass er stimmen musste. Jetzt, da sie in dem fremden Bett lag und ihre Gedanken kreisten, hallten die Worte in ihr nach. Sie tat Männern nicht gut. Den Mann, der jetzt neben ihr schlief, hatte das womöglich nicht gestört, aber viel wahrscheinlicher war, dass er es gar nicht erst bemerkt hatte. Oder dass er einfach schon vorher traurig genug gewesen war. Er hatte noch am selben Abend angerufen, es war unkompliziert mit ihm. Sie ließ ihn erzählen, von seiner Arbeit, von seinen Freunden, und er fragte sie nach ihrem Studium aus, so lange, bis er merkte, dass es ihr unangenehm war, davon zu sprechen. Er gab ihr das Gefühl, interessant und begehrenswert zu sein, und an diesem Abend hatten sie sich zum Essen verabredet. Wieder war alles ganz einfach. Im Grunde genommen war es immer einfach, wenn Irene sich auf solche Verabredungen einließ. Sie hatte sich ein Kleid und die hohen Schuhe angezogen, sie tranken beide Wein, und als es zu kühl wurde, um draußen zu sitzen, war längst klar, dass sie mit zu ihm kommen würde.
Sie hatten sich vor seiner Wohnungstür geküsst, sie hatte nicht warten wollen, bis er aufgeschlossen hatte, und drinnen hatte sie sich ausgezogen. Sie hatte das Kleid über den Kopf gezogen, war aus dem Slip gestiegen und ließ die Schuhe an bis zum Schluss. Sie gefielen ihm. Irene gefiel ihm. Sie war nicht mehr sicher, ob sie gesprochen hatten, seit sie aus dem Restaurant weggegangen waren. Er hatte sie aus der Distanz betrachtet, ehe er auf sie zukam, noch immer angezogen, und sie ins Schlafzimmer führte. Er war auch noch angezogen, als er ihre Brüste streichelte, sie küsste, dort, überall; er spreizte ihre Beine und leckte sie. Er machte das gut. Ihr gefiel, wie gierig er war. Sie hatte ihn viel zögerlicher eingeschätzt. Und ungeschickter. Erst als es ihr gekommen war, zog er sich auch aus.
Irene war jedes Mal erstaunt, wie anders Menschen aussehen, wenn sie nackt sind, und wie anders ein Gesicht aussieht, wenn es sich nähert, um einen zu küssen. Als hätte das Gesicht, das einen küssen will, nichts zu tun mit dem Gesicht, das mit sicherem Abstand spricht, lacht und isst. In dem Moment, als er seine Kleidung ablegte, sie küsste und zu sich zog, um in sie einzudringen, da gefiel ihr der Mann sogar ein bisschen.
Nun fiel Sonnenlicht zwischen den Vorhängen ins Zimmer. Es wurde früh hell, und innerhalb weniger Minuten war die Nacht vorbei. Der Mann drehte sich zu Irene um und legte seine Hand um ihre Taille. Es fühlte sich richtig an, als ob seine Hand und ihre Taille ganz selbstverständlich zusammengehören würden, und er streichelte sie eine Weile, ehe er zu sprechen begann.
»Wie magst du deinen Kaffee?«
Der Mann hatte Schlaf in den Augen und seine Haare lagen platt an der Seite seines Kopfes. Er wirkte ausgeruht. Und glücklich, oder wenigstens nicht traurig. Irene machte sich trotzdem nichts vor. Ihr war klar, dass sie nicht bei ihm bleiben und ihn nur wieder enttäuschen würde. Aber für einen kurzen Moment färbte seine Freude auf sie ab, sie war zufrieden, weil er es auch war, und sie lächelte.
»Schwarz, bitte.«
Er brachte ihr die Tasse ans Bett und strahlte sie an wie jemand, der ein Lob erwartet, weil er etwas Großartiges gemacht hat. Um seine Augen herum zeichneten sich Falten ab, wenn er so leise vor sich hin lachte.
Irenes Blick fiel auf die Bilder an der Wand, die Kinderzeichnungen. Manchmal genügte so ein Augenblick, so eine Kleinigkeit, die störte, obwohl sie gar nicht wichtig war, um Irene daran zu erinnern, dass sie nirgends bleiben wollte. Irgendetwas hielt sie immer fern, von allen. Auf einem der Bilder war eine grüne Wiese mit einem Baum, dieses hatte sie am Abend noch nicht gesehen. Sie fragte sich, warum das Kind keine Menschen malte. Die meisten Kinder, die sie kannte, malten ihre Eltern oder ihre Geschwister, oder irgendwelche anderen Kinder. Hier waren nur verlassene Häuser und Wiesen und lachende Schmetterlinge. Irene glaubte nicht, dass sie das Kind besonders mögen würde.
»Du, ich muss bald los. Bitte entschuldige. Danke für den Kaffee, der tut gut. Und danke, dass ich hierbleiben durfte.«
Er wollte sich seine Enttäuschung nicht anmerken lassen, tat es aber doch, jedenfalls glaubte Irene, sie ganz deutlich zu sehen. Sie mochte die Stimmung nicht, die nun zwischen ihnen entstand; sie mochte ihr Weggehen nicht begründen und seine Traurigkeit nicht länger sehen. Sie ging ins Bad, schloss die Tür hinter sich ab und setzte sich auf eine Wäschetruhe. Sie hatte weder eine Zahnbürste dabei noch irgendetwas anderes, das sie hätte gebrauchen können, um die letzte Nacht von ihrem Körper zu waschen, zu putzen oder zu schrubben, aber der Platz auf der Truhe war ihr für den Augenblick trotzdem recht. Unter dem Deckel lugte ein weißer Zipfel hervor. Irene erhob sich und zog daran; es war ein T-Shirt. Sie grub ihr Gesicht tief in den Baumwollstoff und atmete ein. Er war weich und roch gut. Nach Waschmittel, der Haut des Mannes, nach seinem Duschgel, ein wenig verschwitzt. Sie faltete es zusammen, rollte das gefaltete T-Shirt wiederum auf, bis es so klein war, wie es nur sein konnte, und ließ es auf dem Weg zurück zu dem Mann in ihrer Tasche verschwinden. Er merkte nichts davon und lächelte sie zum Abschied an. Er hatte kleine Grübchen auf den Wangen und wieder diese Lachfalten um den Mund, aber in seinen Augen las Irene noch etwas anderes, etwas Trauriges, vielleicht eine Ahnung, dass das, was er sich von Irene wünschte, keine Aussicht auf Erfüllung hatte.
Er versuchte danach noch ein paar Mal, sie anzurufen, doch nach einigen Tagen gab er auf. Irene fuhr oft mit dem Rad durch die Gneisenaustraße, wenn sie auf dem Weg zur Uni war. Dann dachte sie an ihn. Sie war nicht mehr sicher, welches der Häuser seines war, also suchte sie eines aus, das es hätte sein können: einen besonders prächtigen, restaurierten Altbau mit Balkonen im Vorderhaus. Wenn sie daran vorbeifuhr, wagte sie kaum hinzusehen, beschleunigte das Tempo und richtete den Blick ganz gerade auf den Radweg vor ihr.