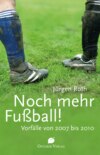Loe raamatut: «Anschwellendes Geschwätz»
Roth
Anschwellendes
Geschwätz

Essay 10
Jürgen Roth
Anschwellendes Geschwätz
Kleine Chronik
des kommunikativen Krawalls

Jürgen Roth, geboren 1968, lebt als Schriftsteller »auf den Spuren von Karl Kraus« (junge Welt) in Frankfurt am Main. Zuletzt erschienen sind u. a. (zusammen mit Stefan Behr und Wolfgang Hettfleisch) Wichtig ist, wer hinten hält – Fouls und Schwalben in Fußball und Politik (Berlin 2005) und (zusammen mit Michael Sailer) Deep Purple – Die Geschichte einer Band (Höfen 2005).
Titel aus dem Oktober Verlag: Die Tränen der Trainer – Wichtige Fußballbegebenheiten (2001) sowie Die Poesie des Biers (2003).
© 2005 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung des
Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Tom van Endert
Titel unter Verwendung eines Photos von Jürgen Roth
ISBN 3-938568-35-4
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
Inhalt
Es war einmal das Adornowahrjahr
Mission Intervention
Mission Moneten
Leise rieselt der Milzbrand
Verschweinskopfung
Kraus und Kant
Der Sportloser des Jahres 2002
Sprachskitch
Supismus
Transzendentale Reform
Nix krank
Krautlese
Wortfeldpost (Linguistischer Bericht)
Prügelstrafe für Sätze
Ein Kind Gottes
Viel Licht
Tausendjähriger Kraus
Das Planf in Kunst und Kultur
Wegwerfliteratur
Kwulst und Kwalst
Langbärtigkeit
Unser Luschigster
Im Gewöhnlichen
Von deutschem Mund zu Mund
Café Kanzler
Reaktionärer Racheengel
Ohne vieles
Toilettenkultur
Der beste Typ der Welt
Sinnquerulant
Höre, nix
Rührung und Radau
Satz für Satz
Meine Henscheid-Lieblingsstelle
Dichter deutscher Lallzunge
Neun Freunde
Rochus
Übernachten
Tante Tantra
Gottes Geld
Die Gesellschaft der Bindestrichgesellschaft
Wirklichkeit oder Wahrheit oder: Das Ende der Rede
Sex
Tortur de force
Great Amerika
Dialogos
Stimmig
OF PC
Komikwörter
Entscheidung oder Scheidung
Die F-Frage
Wie Martin Walser eine klasse Romanmasse stemmte
Gute Literatur (Vorschlag zur gerade schon wieder verwesenden »Walser-Debatte« und zu anderweitig Wichtigem)
Schwierig
Generation Lust
Schweinepidginsang
Quatsch mit Drogen
Rockreliquie
Rock Hard Core
Unglaublich
Poetry Schlamm
Poetologie und Praxis der Büttenrede
Wustmann und Lorio’t
Von Grimm und vom Grimmen
Hock around the clock
Beim Bartleby des Rudi Völler
Sinnschrunden
Meine Lieblingsminute
Purster heißer Eiseneffe
Laberfiasko
Maulwürfe für bärtige Korbmäuler
Bremsen ist die Kunst
Laudatio auf Lauda
O-Thon
Rackerndes Dreamteam
Einwandfrei ethisch
Die lange Welle der Reflexion
Die Seite 100
Erste Sätze
Der Videotextmönch
Flieg, Phoenix, flieg!
Welt im Sack
Koksspreizer
Das Runterziehen beim Lesen
Das Durchsteh’n
Ein starkes Struck Deutschland
Wer den Schlag hat
Zwei extreme Pfeifen
Der große Unterschied
Helle und Koschi
Ausgeglotzt
Intellektuellenindustrie
Was würde Beckenbauer zu Adorno sagen?
Classisches Denken
Doofenverwahrung
Idylle über den Müßiggang
Metasprache
Das süddeutsche Denken in Zeiten schwerer Ungleichzeitigkeit
Above Schmidt
Glamourgammel
Die Tautologiker
Daß kommen Nöte
Rosige Runde
Preistreiben 2003
The Aufschwung
Kritisch
Denker, Lenker und Entscheider
Europa rotzt retour
Hörrohroffen
Metakritik des Medieneis
Die Rolltreppe
Es reicht
Radiohöhepunkt
Die List(e) der Listen
Nichts
Wahrer als Wittgenstein
Antwort auf alles
Schriftsteller werden
Leistungszettels Alptraum
Konfliktkommunion
Das Nichts
Die Schweigespirale
Nachweise
Es war einmal das Adornowahrjahr
Adorno war »ein philosophierender Intellektueller«, schrieb Jürgen Habermas 1963 anläßlich des sechzigsten Geburtstages von Adorno, und Adorno war, so Habermas weiter, »ein Schriftsteller unter Beamten«.
Die Beamten waren die Schulphilosophen, diejenigen, die den systematischen und deduktiven Zwängen der universitär vermittelten Lehren gehorchten und einer Sprache dienten, die weniger an Philosophie – als ein Philosophieren – denn viel-mehr an Verwaltung gemahnte.
Adornos kreisender Stil widersprach der Sprache der bürokratischen Philosophie in der verwalteten Welt vehement. Und so sehr Adorno das Geschäft der Philosophie von innen her zu decouvrieren und dergestalt die Wahrheit der Reflexion auf das Schicksal des Subjekts philosophisch zu retten versuchte, so sehr war ihm oft danach, die »Eiswüste der Abstraktion« zu fliehen und z. B. bergzuwandern.
Das Jahr 2003 war, man mag sich daran vielleicht trotz aller Beschleunigung der Quasselkonjunkturabfolgen noch erinnern, mutmaßlich mehr als alles andere: das Adornojahr, und zur Feier des hundertsten Geburtstages des »interdisziplinären Einzelarbeiters«, wie Rolf Wiggershaus in seiner Studie Die Frankfurter Schule den Soziologen, Aphoristiker, Literaturexegeten, Husserl-Deuter, Musikphilosophen und Komponisten nannte, versuchten Symposien, Festakte, Konzerte, Liederabende, Preisverleihungen, Straßenumbenennungen und Ausstellungen den »ganzen Adorno« vorzustellen, d. h. »Leben und Werk« in Einheit, in der großen Synthese zu zeigen.
Deshalb durfte im Vorfeld auch damit gerechnet werden, auf bis dato unbekannte Aspekte des »Adornoschen« (Wiggershaus) Schaffens, Wirkens und Wandelns aufmerksam gemacht zu werden. Einen frühen Hinweis hatte die Frankfurter Ausgabe der Bild-Zeitung gegeben, in der über den Jubilar zu lesen gewesen war: »In der Welt der Philosophie, der Sozialpolitik und der Musik hat er Frankfurt berühmt gemacht.«
Sozialpolitik – interessant. Adorno: ein engagierter Referent in Sachen Mieterschutz, öffentlicher Wohnungsbau und Kindertagesstättenproblematik? Das klang ehrenwert und stellte jedoch nur ein erstes Steinchen jenes schillernden Mosaiks dar, das anschließend vor unseren Augen zusammengesetzt wurde, um uns den ungeschmälerten, den »wahren Adorno« zu präsentieren.
Adorno nämlich war in seiner Funktion als Leiter und oberster Skatspieler des Instituts für Sozialforschung auch ein bedeutender Blondinenforscher und Champagnerverehrer. Und Adorno war ein antizipatorischer Olympiagegner und unermüdlicher Boulespieler, ein eifriger Sommerhutfan und ausgefuchster Eintracht-Experte, der die prekären finanziellen Verhältnisse des launischen und verluderten Vereins durch mehrere Gutachten und Strategiepapiere nachhaltig zu verbessern trachtete.
Adorno war darüber hinaus, das dokumentiert ein Photo, das jahrelang an der Wand des studentischen Cafés im Philosophischen Institut der Universität Frankfurt hing, ein begeisterter Pappnasenträger, der im kindlichen Übermut seinen alten Kumpel Horkheimer sogar beim Wettlachen ausstach, und zwar deutlich nach Pappnasenpunkten.
Erinnert sei aber auch an ein Wort von Oskar Negt: »Adorno war ein solider Uhrmacher.« Und erinnert sei daran, wie zum Beschluß des ganzen Adornojahrgedackels im Lokalteil der Frankfurter Rundschau vom 30. Dezember 2003 ein Resümee zu all der besinnungslosen »Besinnung auf das Universalgenie Theodor W. Adorno« gezogen wurde: »Eine Streitkultur, wie sie sich an seiner Denke bis heute entzündet, könnte die Stadt unterdessen gut gebrauchen. Eben nicht nur in den hochgeistigen Diskursen, die das Adorno-Jahr gebracht hat.« Sondern, die schauderhafte »Denke« weiterdenkend in Richtung Sozial- und Stadtpolitik: »Mancher hat Vertreter der Stadtpolitik auf den Podien vermißt.« Und Sozialpolitiker, die mit Adornos »Denke« im »Kopf« »eine politische Debatte entzündet« hätten. Denn »Politikern müßte doch daran gelegen sein, daß die Lähmung durch Spar- und Gelddebatten überwunden würde«. Und sei’s durch ein derart versautes Denke- und Debattengeschwafel right out of the »Pig Press« (Eckhard Henscheid).
Zwischen Bild und lokaler Frankfurter Rundschau: nur noch ein gradueller Unterschied. Bild enthält sich – noch – des »Diskurses«, die seriöse Tochter hat dafür die »Streitkultur« in petto, eine Streit- und Stammelkultur, die sie trotz der simultan und sogar auf Seite eins ausgelobten »Verzichtskultur« weder einzudämmen noch abzuwracken gedenkt. Warum auch? Das Blatt befindet sich in einer glanzvollen Gesellschaft aus Zeitungen, Magazinen, Fernsehkanälen und sonstigen Institutionen und Instituten, in der wenig anderes betrieben wird, als unaufhaltsam den von Adorno halb beklagten, halb analytisch entblößten »Schwindel der Kommunikation« zu verbreiten und, so das denn geht, zu verbreitern. Oder einfach bloß wie wild weiterzutreiben. So daß vor lauter sinnfällig anschwellendem Schwindel füglich über einen nahezu mediendichten Schwindel des Geschwätzes gejammert werden darf, der sich, sofern zu allem Überdruß noch die Medien- und die Kommunikationswissenschaften ihr abgestandenes geistiges Scherflein beitragen, im Hybrid- und Metaschwindel des »Geschwätz-Geschwätzes« (Roland Tauber) vervollkommnet.
Man kann darüber lachen, man kann deshalb brechen, man kann im praktisch parallel eröffneten Paralleluniversum des stern und in dessen erster Ausgabe des Post-Adornojahres den im alten Sinne reaktionären Gehalt des Geschwätzes über das Geschwätz der Politik zur Kenntnis nehmen, die herrschsüchtige Gesinnung des immerzu »identisch« (Adorno) faselnden Politfeuilletons, für das zumal und im Erörterungszusammenhang der bestenfalls noch bestens erinnerlichen Bohlen- und Harald-Schmidt-Hysterie der ruchlose Zwischenrufer Hans-Ulrich Jörges zuständig ist. Der wußte nicht nur von einem alles und jeden einbegreifenden »Krisensyndrom« der sog. »verbohlten Republik« zu berichten, sondern sorgte sich zudem »um die Leere und ums Anschwellen«, ums allgemeine und allerörtliche Anschwummsen oder Dickmachen, durch das »ein ganzes Land zum geistigen und politischen Vakuum« werde, ausgenommen jener hohe Ort am Hamburger Baumwall, von dem aus in den »Leerraum Deutschland« hineingejörgelt wird, bis die dicken Eier des Propheten bersten.
Da heißt es natürlich, es prinzipiell besser zu wissen und sich »dialektisch« (Jörges) mit Bohlen wie Schmidt »gegen den Strich« gemein zu machen (»Beide haben einen klaren Blick für die traurigen Umstände«), um, man sagt es halt noch mal, »am Ende des deutschen Vakuum-Jahres 2003« in die vollen zu keifen, auf daß der eingebildete Diskursführer der Journaille erhört werde: »Das Denken pausiert schon länger in Deutschland. Und nicht nur das Denken. Das Land steht. Still, aber geschwätzig. Der Reform-Vodoo am Jahresende ist nicht mehr als ein Erzittern. [...] Grell überschminkte Feigheit. Die Gesetze der Ökonomie diktieren nicht weniger als die Neugründung eines erstarrten Landes – erstarrt durch die Pervertierung der Sozialsysteme ins Unsoziale, die Infizierung der Wirtschaft mit der bürokratischen Sklerose des Staates, die Verirrung der Politik im Gestrüpp des Konsensdschungels. [...] Die Großdenker der Siebziger und Achtziger sind erfüllt vom Ekel der Ökonomie, die Feuilletons beschweigen die Grundsteinlegung für eine andere Republik. Kein Diskurs, nirgends.« Wenn’s denn stimmte, das mit dem Diskurs – es ist ja noch ein Jörges da.
Man darf indes, abseits solcher dialektischen und diskursivkommunikativen Adorno-Bomben, unterm Leit- und Titelbegriff des »anschwellenden Geschwätzes« auch das eigensinnige und ungebändigt krumme Parlieren, das wahrheitsfähige Sprechen, das end- wie regellose Gerede derer verstehen, die selten oder nie über ein mediales Forum verfügen und die den »Diskurs« so eindringlich meiden wie die »Debatte« oder die »Kultur«. Man kann sie daher hie und auch da wenigstens kurz zu Wort kommen lassen. Denn im Anfang war, mit Herder zu reden, das menschliche Wort, die »Besonnenheit«, und so wird es bleiben, selbst wenn das ohrenbetäubende Geschnaube in den Reziprokwelten der Presse, der Politik und der »Kulturszene« (Frankfurter Rundschau, s. o.) davon selten etwas wissen möchte – und dafür um so mehr von den eigenen tosenden Angelegenheiten.
Gewiß, manch einer und manch einem der hier zusammengepferchten Glossen und Aufsätze über die Kommunikationskatastrophen der jüngeren Zeit haftet ein gerüttelt Maß an überholter Aktualität an, vor allem auf Grund der grandios rasanten Umwälzung der neusten Republikverhältnisse durch die vorgezogenen Bundestagswahlen am 18. September 2005. Literatur, und sei’s weitgehend polemisch legierte, vermag mit dem galoppierenden Unsinn längst nicht mehr Schritt zu halten. Trotzdem sollte den in Rede stehenden Texten der Eingang in dieses Buch nicht verwehrt werden – wenn auch bloß aus Motiven der nietzscheanisch-archivarischen Geschichtsfortschreibung und im Sinne einer kleinen kakophonischen Dokumentation des kommunikativen Krawalls. Zumindest unter solchen Aspekten ist der Wiederabdruck derartiger Einlassungen dann womöglich sogar eschatologisch gerechtfertigt. Dafür spricht ein furioser, 2005 in den USA zum Bestseller avancierter Essay des emeritierten Princeton-Philosophieprofessors Harry G. Frankfurt mit dem Titel On Bullshit (frei übersetzt nach Robert Gernhardt: Vom Scheiß der Zeit), dessen Kernthese die taz so zusammenfaßte: Eine »der hervorstechendsten Eigenschaften unserer Kultur« sei: »das Blödsinnquatschen, das Rumpalavern, das Heiße-Luft-Produzieren – oder schlicht ›bullshitting‹, wie man es so schön prägnant im Englischen ausdrückt«.
Mission Intervention
Das war eine gute Nachricht. »Nicht selten wurde der rote Teppich ausgerollt«, berichtete die WELT am 4. Januar 2003 über die kurz zuvor getätigte Reise des Günter Grass in den Jemen – in ein von Stammesfehden heimgesuchtes, »bis an die Zähne bewaffnetes Land«, das sich »finanziell verausgabt« hatte: zum Wohle der zwölfköpfigen Delegation, zum Wohle der jemenitischen Tradition des Lehmbauhandwerks, der Grass als Gegenleistung für die entgegengebrachte Gastfreundschaft mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro das Überleben sichern will, und zum Wohle des Nobelpreisstaatsgastes im besonderen: »Das Reisegepäck gewann von Station zu Station an Gewicht: silberne Krummsäbel, Schmuck für die Gattin, eimerweise Honig und pfundweise Kaffee, Folklore und Kostbarkeiten.«
Von Gewicht waren auch die Worte, die Grass, der »übrigens unerschrocken und mutig« das »wunderschöne Land« durchkreuzte, zwischen islamoradikal-präsidialer Ordensverleihung, Wasserpfeifenrunde und Bankett an arabische Dichterkollegen und, in einem Interview mit dem TV-Sender Al Dschasira, an die Welt richtete. Erst wollte er »unverblümt über Erotik in der Literatur sprechen«, dann äußerte das sonnige Gemüt beim Fernsehen: »Ich bin dafür, daß wir jetzt alle nackt baden gehen.« Das mochten sie zwar nicht, dafür liegt Grass nun eine Einladung in den Irak vor. Die Reise war ein voller Erfolg.
Baden hingegen ging wenig später die Mission des Menschenrechtstrios Günter Wallraff, Rupert Neudeck und Norbert Blüm. Diese drei guten Geister wollten gleichfalls eine Reise tun, nach Tschetschenien und Inguschetien. Es kam jedoch nur zum Anreisen. Die Behörden am Moskauer Flughafen verweigerten der trinitätischen Betroffenheitstruppe ohne Angabe von Gründen die Einreise. »Die Jungs waren ausgesprochen ruppig«, erzählte Blüm als pars pro toto der Menschenrechtsvertreter der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (12. Januar) und erklärte der Heimat das gemeinsame, leider gescheiterte Ansinnen: »Wir wollten Berichten nachgehen, denen zufolge die russische Armee dort die Menschenrechte verletzt.«
Es blieb also bei einem Zeitungsgespräch und einem schmukken Photo mit drei verkniffenen Gesichtern. Aber die Absicht zählt.
Ohne Einladung und somit auf ganze eigene und uneigennützige Initiative war derweil eine elf Frau und Mann starke Gruppe rund um die Tübinger Gesellschaft »Kultur des Friedens« gen Irak aufgebrochen, um nicht zu intervenieren, sondern um sich mal ganz global zu solidarisieren oder vielleicht doch eher zu sondieren, was so los und wie die Lage ist. Die Frankfurter Rundschau zitierte unter der sehr richtigen Überschrift »Kultur & Engagement« das prominenteste Mitglied der höheren diplomatischen Kurzzeitvereinigung, Liederhannes Konstantin Wecker: »Wir möchten den Menschen in Deutschland berichten, was wir dort gesehen haben, und für den Frieden werben.« Außerdem wollte er den Menschen in Bagdads und Basras Kulturhäusern, Kliniken und Universitäten beweisen, »daß es auch westliche Menschen gibt, die keine Waffeninspekteure sind«. Diese Menschen sind freigiebig, weil sie Spielzeug und Gitarren mitbringen und ein Gratiskonzert geben. »Die Mission der Reise«, erweiterte Wecker live aus Bagdad gegenüber der taz (15. Januar) allerdings die Motive seiner Handlungsweise, »war nicht das Konzert. Ich möchte diesen Krieg verhindern.« Für die Zeit danach kündigte er weiteren Einsatz an: »Ich will beispielsweise in Bibliotheken nachfragen, ob sie alte Noten haben, die wir hierher schicken können.«
Während Wecker und die aufrechten zehn ein »Friedenssignal« (Frankfurter Rundschau) setzten, hißten schon im Dezember 2002 dreiunddreißig »Hamburger Künstler« die Kriegsfahne und schalteten im Hamburger Abendblatt eine Annonce, mit der sie sich für einen Baustopp bei der Airbus-Werkserweiterung im Stadtteil Finkenwerder stark machten. Die Philippika, die u. a. der Filmregisseur Hark Bohm unterzeichnet hatte, klagte die Hinterlist der Hamburger Politik an, die im Vorfeld und vollen Wissen Öffentlichkeit und Gerichte über die wahren Absichten des Luftfahrtunternehmens getäuscht habe, über eine dem Planfeststellungsverfahren zuwiderlaufende Verlängerung der Start- und Landebahn z. B. oder die Zuschüttung des Naturschutzgebietes Mühlenberger Loch.
Ausgesprochen angesprochen und angegriffen fühlte sich darob der ehemalige, an der Planung federführend beteiligt gewesene SPD-Wirtschaftssenator Thomas Mirow (gegen ihn wurde Anzeige wegen Betrugs erstattet). Er schlug zurück, veröffentlichte im Abendblatt vom 16. Dezember einen offenen Brief an seinen Freund, den »lieben Hark«, und entkräftete die Vorwürfe betreffs einer angeblichen »Lex Airbus« (erschlichene Gemeinnützigkeit usf.), diverser Mauscheleien im Aufsichtsrat und etwaiger »Katastrophenszenarien«, um zu schließen: »Künstlerinnen und Künstler sind wichtig für unsere Gesellschaft. Mir liegt deshalb an der Möglichkeit zum offenen Gespräch über Tatsachen und Meinungen anstelle von bösen oder gar bösartigen Unterstellungen.«
Das ließ sich Hark nicht zweimal sagen und zeigte, was eine Harke ist. Am 20. Dezember legte er in eigener Mission und einem nicht nur betroffenen, sondern offensichtlichst auch besoffenen offenen Brief via Abendblatt seine Meinungen und Tatsachen dar. »Lieber Thomas«, weinte es da aus dem Armenviertel, dem Elbvorort Großflottbek, wo dem Bohm sein Häuschen prangt, »meine Tochter, die zwei Kilometer weiter elbwärts in der Schule sitzt, wird dreimal kurz hintereinander aus dem Unterricht gerissen. Und mit ihr mindestens 3.000 andere Kinder.« Schuld seien die mit »Vollgas« und voll niedrig über ihn, Hark, und 3.000 andere Kinder hinwegfliegenden Flieger, die viel »Abgas« ausspien und ein immenses »Absturzrisiko« darstellten. Außerdem seien bloß 2.000 statt, wie versprochen, 4.000 Arbeitsplätze geschaffen worden, und die »demokratische Moral« verletze vollends, daß diese Garantie von ihm, dem Thomas, bewußt vorgeschoben worden sei: »Auf eine unverbindliche Zusage hin belastet der Staat Hamburg meine Familie mit Lärm und Dreck [...]. Er verwandelt das schönste Stück englisch-hanseatischer Gartenkultur, den Jenischpark, zu einer ungenießbaren Einflugschneise. Er zerstört den Strom Elbe, der die identitätsstiftende Metapher für meine Heimat Hamburg liefert. Der Staat zerstört die Heimat meiner Familie. Gerade als Sympathisant der Sozialdemokratie fühle ich mich bitter enttäuscht.« Und das, Hand auf die Metapher des Staates der Sozialdemokratie, der ohne Identität Harks Familie zur Ungenießbarkeit des Lebens ausliefert, »treibt uns Künstler auf die Barrikaden«.
Weshalb sich Hark (63, Film) von Thomas und seiner verlogenen Sozialdemokratie (sie »verhöhnt den Rechtsstaat«) ab-, dem Wirtschaftssenator Gunnar Uldall (62, CDU) zuwandte und einen wirtschaftspolitischen Überfliegerkatalog aufstellte, der u. a. konzis forderte, nur klitzekleine und moderat-mittlere Airbusse zu produzieren und dies zu tun: »Rückführung des Mühlenberger Lochs in ein Naturschutzgebiet. Nutzung des ins Mühlenberger Loch geschütteten Sandes für den Bau eines Olympiastadions an anderer Stelle.«
Was lehrt uns all das? Der deutsche Intellektuelle ist auf dem Vormarsch und zur Stelle, regional und global – als organischer Intellektueller, wie ihn Gramsci verstand, als in die Produktion eingreifender und für Gerechtigkeit sorgender Aufmischer, Rumtreiber und Freund des Volkes.
Das ist ein Fortschritt.