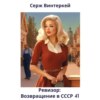Loe raamatut: «Wackernells Visionen»
Die Buchreihe Memoria mit Aufzeichnungen, Tagebüchern und Biografien aus dem 20. Jahrhundert wird über die Arbeitsgruppe Geschichte und Region/Storia e regione von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt.


Leo Hillebrand
Wackernells Visionen
Das Lebenswerk eines Südtiroler Ingenieurs
Mit einem Vorwort von Manfred Ebner

Inhalt
Vorwort
Einleitung
Kindheit an historischer Stätte
Der Ernst des Lebens
Dramatische Ereignisse am Monte Pelmo
Über Umwege nach Hause
Aufbruch zu neuen Ufern
Student in Mailand
Reger Geist in fittem Körper
Schwerer Start
Neue Perspektiven
Private Weichenstellungen
Pionier der Frostschutzberegnung
Die ersten Anlagen entstehen
Fachliche Kontroversen
Siegeszug der Frostschutzberegnung
Debatte um die Brennerautobahn
Projekt Meraner Trasse
Kein Autobahntunnel für Bozen
Statik und Kollaudierungen
Patente und Urheberrechte
Übermächtige Konkurrenz
Schwerpunkt Betriebsgebäude
Towerhouse am Bahnhof Bozen
Lehrer an der Geometerschule
Zwischen Beruf und Freizeit
Passion Segeln
Im öffentlichen Auftrag
Der Flughafen auf dem Berg
Kampf um die Talferbrücke
Die Renovierung des Bozner Pfarrturms
Landeshauptstadt im Fokus
MeBo alternativ
Die Passerdamm-Variante
Vater der Nordwestumfahrung
Die Umfahrung von Naturns-Staben
Leidenschaft Geschichte
Die Via Claudia Augusta
Römerbrücke und Diana-Altar
Vom Castrum Maiense zum Schloss Ortenstein
Ein rüstiger Senior
Norbert Wackernell – Eine Einschätzung von Zeitzeugen und Weggefährten
Anmerkungen
Mit freundlicher Unterstützung der Abteilung Deutsche Kultur in der
Südtiroler Landesregierung und dem Amt für Europäische Integration und Humanitäre Hilfe in der Autonomen Region Trentino-Südtirol

© Edition Raetia, Bozen 2021
Grafisches Konzept: Dall’O & Freunde
Druckvorstufe: Typoplus
Lektorat: Jochen Hemmleb
Fachlektorat: Adina Guarnieri für Geschichte und Region/Storia e regione
Korrektorat: Helene Dorner
Projektleitung im Verlag: Felix Obermair
Gedruckt in der EU
Die Bilder stammen aus dem Fotobestand von Norbert Wackernell, mit Ausnahme von:
S. 150: Marktgemeinde Naturns (Hrsg.), Umfahrungsstraße Naturns-Staben. Ein Jahrhundertwerk, Naturns 2003
S. 152 und S. 153: Archiv Manfred Ebner
Titelbild: Norbert Wackernell vor dem Damm des Tarbela-Stausees in Pakistan, 1976
ISBN 978-88-7283-795-5
Vorwort
Manfred Ebner
Zum ersten Mal hörte ich von Ing. Norbert Wackernell in den 1960er-Jahren im Rahmen der Diskussion über die Brennerautobahn. In Meran löste der Vorschlag, die Autobahntrasse über das Stadtgebiet zu führen, viele kontroverse Diskussionen aus. Der Gemeinderat war damals geschlossen für diese Lösung, zu der es aus Meraner Sicht aber glücklicherweise nicht gekommen ist. Nach meinem Ingenieursstudium in Graz arbeitete ich sieben Jahre als Mitarbeiter bei Wackernells Konkurrenten Ing. Georg Plattner an Projekten in Südtirol. Man hörte damals von vielen Studenten der Bozner Geometerschule, wie unerbittlich streng Wackernell dort als Lehrer war.
Mich haben immer wieder Wackernells oft utopische Studien beeindruckt, die in der Presse vorgestellt wurden, wie zum Beispiel die Planung des Flughafens am Salten. Wackernell hat in besonderer Weise gezeigt, dass der Ingenieur nicht ein alles berechnender Techniker ist, sondern dass die Kreativität das Wesentliche an der Ingenieurskunst ist. Er ließ sich nicht von den Worten „das ist zu teuer“ oder „das ist ein verrückter Vorschlag“ abschrecken und ließ seiner Kreativität stets freien Lauf. Wackernell war bekannt dafür, innovativen, mitunter aber auch weltfremden Ideen nachzuhängen. Er vertrat schon früh Lösungen, die sehr aufwendig und teuer waren, wie etwa Umfahrungsstraßen in Tunnel zu versetzen. Er strebte stets die optimale Lösung für die Umgebung an. Allerdings entwickelte sich der Zeitgeist in Wackernells Sinne und er kam beispielsweise mit seinem Umfahrungsprojekt für Naturns-Staben – für Kenner der Szene eigentlich überraschend – zum Zug.
Trends setzte Wackernell auch in der Öffentlichkeitsarbeit: Nachdem er einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hatte, setzte er die Medien gezielt ein, um seine Ideen weiterzubringen. Er spielte diesen seine Studien zu, um zu vermeiden, sich in kleinlicher Überzeugungsarbeit gegenüber den zuständigen Beamten aufzureiben.
Ich lernte Wackernell 1989 kennen, als er, Ing. Aribo Gretzer und ich von der Südtiroler Landesverwaltung den Auftrag zur Planung der Nordwestumfahrung von Meran erhielten. Er war es, der den Mut hatte, eine vollständig unterirdische Unterquerung der Stadt vorzuschlagen. Es war eine sehr harmonische Zusammenarbeit. Die Planungszeit war begleitet von massiven Protesten von Gegnern dieser Umfahrung. Diese erhielten viel Zulauf, auch begünstigt von einer gezielten Falschmeldung in einer Zeitung, dass eine Ausfahrt mitten in der Stadt vorgesehen sei. Nach Genehmigung des Vorprojektes zog er sich zu seinem 80. Geburtstag von der Planung zurück. Immer wieder war aber von neuen Ideen in der Presse zu lesen. Er tüftelte ständig an Verbesserungen herum, gab sich nie mit etwas zufrieden. Nach Ausarbeitung und Genehmigung unseres gemeinsamen Vorprojektes (Ebner-Gretzer-Wackernell – Anm. d. Verf.) zur Meraner Nordwestumfahrung überraschte er uns zum Beispiel mit seiner „Passerdammvariante“, die Ing. Gretzer und ich beim gegebenen Stand der Dinge natürlich ablehnten.
Von Wackernell erfuhr ich in persönlichen Gesprächen, dass er in Sichtweite von meinem Geburtshaus auf der anderen Passerseite aufgewachsen war, mit meinem 22 Jahre älteren Bruder Sport getrieben und mit ihm die gleichen Schulen besucht hatte. Zusammen mit den beiden anderen Planern der Nordwestumfahrung blieben wir auch, nachdem er nicht mehr Mitglied der Planungsgruppe war, in Kontakt und waren unter anderem mit ihm und seiner Frau in Wolkenstein zum Skifahren eingeladen. Ein besonderes Erlebnis war die Vorstellung seines Buches auf der Zenoburg 2019, zu der er Ing. Aribo Gretzer und mich eingeladen hatte. Hier konnten wir erleben, wie kreativ er trotz fortgeschrittenen Alters geblieben war.
Das letzte Mal gesehen habe ich ihn 2020 beim Baubeginn des zweiten Bauloses der Nordwestumfahrung mit dem Küchelbergtunnel. Ich hatte ihn vorher angerufen und gebeten, unbedingt dabei zu sein. Obwohl er bereits sehr gebrechlich war, ist er gekommen und hat eine ganze Mappe von Zeitungsausschnitten über dieses Projekt mitgebracht und mir gezeigt.
Einleitung
Am Anfang waltete der Zufall: Ich war bei meiner Arbeit für das Dorfbuch Nals – Geschichte und Geschichten auf den Namen Norbert Wackernell gestoßen. Ich betreute das Thema Landwirtschaft, und es war der Meraner Ingenieur, der Mitte der 1950er-Jahre in Nals für eine der ersten großen Beregnungsanlagen Südtirols verantwortlich zeichnete. Nahezu 60 Jahre nach ihrer Fertigstellung rief ich im Rahmen meiner Recherchen ein Studio Wackernell in Bozen an, um nach so langer Zeit nachzufragen, ob es denn noch Unterlagen zu dieser Anlage gebe. Am Telefon antwortete mir ein resolut wirkender Mann mit kräftiger Stimme. Erst war ich etwas verwirrt, doch dann begriff ich, dass es sich nicht nur um das richtige Studio handelte, sondern ich den Entwickler der Nalser Anlage persönlich am Apparat hatte. Das war mein erster Kontakt mit Norbert Wackernell. Da das Gespräch gleichermaßen interessant wie ergiebig war und mir sein Name in der Folge noch öfters unterkam, ergab es sich, für die Rubrik „Geschichte am Freitag“ in der Neuen Südtiroler Tageszeitung eine biografische Skizze von ihm zu verfassen. Es folgten zwei ausführliche Gespräche im Februar und März 2017 und der entsprechende Zeitungsartikel.1 Dabei wurde mir erst bewusst, wie facettenreich und vielfältig Leben und Werk dieses Ingenieurs waren, wie zahlreich seine Projekte, an denen er in der einen oder anderen Form beteiligt war. Weil das Genre Biografie zu den Schwerpunkten meines Curriculums zählt, war der Gedanke naheliegend, dieses gleichermaßen beruflich wie privat bemerkenswerte Leben in Buchform aufzuarbeiten. Wenn das Leben von Norbert Wackernell von objektivem Interesse ist, dann in erster Linie, weil es in vielerlei Hinsicht das Klischee vom Leben des typischen Südtirolers der Zwischen- und Nachkriegszeit kontrastiert: Er stammt nicht aus bäuerlichem Milieu, er hatte nicht zahlreiche Geschwister, er litt nicht unter der Schule im Faschismus, er musste sich nicht mit abstrakten Berufswünschen zufriedengeben, weil die Eltern bildungsfern waren oder sich die Ausbildung der Kinder schlichtweg nicht leisten konnten. Der 1927 geborene Wackernell steht vielmehr für ein Lebensmodell, das in Südtirol erst viele Jahrzehnte später durch den anhaltenden Wirtschaftsaufschwung, die Liberalisierung und Individualisierung der Gesellschaft Verbreitung fand. Auch der Homo Faber Wackernell stellt ein interessantes Modell dar. Nicht so sehr, weil er an zahlreichen bedeutenden Projekten teilnahm und am Ende seiner Tätigkeit als Ingenieur zu den bekannteren Vertretern seiner Zunft zählte. Bemerkenswert ist seine berufliche Laufbahn vielmehr, weil er sich nicht von Beginn auf einen Bereich konzentrierte und dann nur mehr Gewinnmaximierung betrieb. Ob als Lehrer, als Planer so disparater Dinge wie Kegelbahnen, Langlaufloipen oder Laufställe, als Projektant zum Teil kühner Vorhaben –, immer standen die Bereitschaft, Neues aufzunehmen, Motivation, Interesse, ja die Neugierde im Zentrum. Und das bis ins hohe Alter! Mit diesem Buch liegt eine Lebensbeschreibung vor, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern das Typische, Exemplarische herausheben möchte. Methodisch basiert die Arbeit in erster Linie auf insgesamt zehn ausführlichen Interviews, die ich im Spätwinter 2017 bzw. zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 mit Wackernell führte. Zusätzlich wertete ich die von ihm publizierten Texte, vor allem in der Tageszeitung Dolomiten, in der Kulturzeitschrift Der Schlern und im Fachblatt Der Landwirt aus. Er stellte mir außerdem eine Reihe von Manuskripten aus seinem Archiv zur Verfügung, in erster Linie zur Südtiroler Landesgeschichte. Das vielleicht interessanteste Material sind die Mappen mit den technischen Berichten zu verschiedenen Projekten, wobei gerade jene Studien am interessantesten waren, die nicht umgesetzt wurden.
Im Rahmen dieses Buchprojektes erhielt ich Unterstützung von verschiedener Seite: Mein Dank geht an Felix Obermair und Thomas Kager von der Edition Raetia, die diese Publikation durch ihr Engagement ermöglicht haben. Außerdem danke ich den Wackernell-Töchtern Prisca, Lioba und Itta. Sie haben das Entstehen dieses Buches nicht nur wohlwollend begleitet, sondern auch den umfangreichen Fotobestand der Familie zur Verfügung gestellt. Abschließend danke ich der Südtiroler Landesregierung, der Stiftung Südtiroler Sparkasse sowie der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die finanzielle Unterstützung des Projektes.
Kindheit an historischer Stätte
Als der 92-jährige Norbert Wackernell im Juni 2019 auf der Zenoburg über Meran sein Buch Der Zorn der Piltrude und der Bischof vorstellte, schweifte er zurück zu den Stätten seiner Kindheit: die Passeirergasse in der Meraner Altstadt, in der er seine Kindheit verbrachte; der Küchelberg zwischen Pulverturm und eben der Zenoburg, wo sein Vater jenes Haus bauen wird, das Wackernell bis zuletzt bewohnte. Auch wenn er als junger Ingenieur in den 1950er-Jahren seine Zelte in Bozen aufschlagen wird: Die Gegend, in der er Kindheit und Jugend verbrachte, lässt ihn nicht mehr los. Bereits als Universitätsstudent verfasst er 1953 die Studie „Die Entstehung der Stadt Meran“. In den folgenden Jahrzehnten war er als Ingenieur immer wieder in Projekte wie der Meraner Trasse der Brennerautobahn, der Passerdamm-Variante oder der Nordwestumfahrung involviert. Projekte also, die für die Stadt von fundamentaler Bedeutung waren. Ab den 1990er-Jahren schließlich vertiefte sich Wackernell zunehmend in historische Studien zur Entwicklung des Meraner Raumes seit der Römerzeit. Sie zogen den rüstigen Senior bis zuletzt in ihren Bann. Diese Hingabe an die Stätten seiner Herkunft überrascht nicht: Die Landschaft des Küchelberges und der nahen Passer mit der wilden Gilf-Klamm ist bis heute beeindruckend. Zudem waren die Zeitumstände, unter denen Wackernell in den 1930er- und 1940er-Jahren aufwuchs, für den Charakter eines jungen Menschen prägend. Und dies, obwohl seine Kindheit und Jugend grundlegend anders verliefen als für die Mehrheit seiner Generation in Südtirol. In Vielem kontrastieren sie die Südtiroler Zeitumstände geradezu diametral. Im Südtirol der Zwischenkriegszeit herrschten politisch wie wirtschaftlich äußerst schwierige Umstände. Mit dem Übergang an Italien wurde dieser landwirtschaftlich geprägte, bereits zu k. u. k. Zeiten als arm und rückständig geltende Teil Tirols von seinen traditionellen Absatzmärkten jenseits des Brenners abgeschnitten und sah sich gerade im Obstund Weinbau einer direkten Konkurrenz mit inländischen Produzenten ausgesetzt. Zu dieser Grundproblematik kam in den 1930er-Jahren die Weltwirtschaftskrise und mit ihr äußerst harte, von Deflation geprägte Jahre. Berücksichtigt man überdies, dass in einer durchschnittlichen Südtiroler Familie aufgrund des Kinderreichtums die spärlichen Mittel auf viele Köpfe aufzuteilen waren, lässt sich ermessen, unter welch harten Umständen die große Mehrheit der in den 1910er- und 1920er-Jahren Geborenen aufwachsen musste. Norbert Wackernell hingegen wurde in vergleichsweise behütete Verhältnisse hineingeboren. Sein Vater war Ingenieur, zählte also zur Bildungselite des Landes. Die Familie der Mutter betrieb in der Passeirergasse nahe der Santer Klause einen Gemischtwarenladen, der nicht zuletzt deshalb gut lief, weil er direkt an der Durchzugsroute der Passeirer Fuhrwerker lag, die sich vor der Heimfahrt mit Proviant eindeckten. Zudem war der kleine Norbert ein Einzelkind, auf das sich nicht nur die gesamte Aufmerksamkeit seiner Eltern, sondern auch aller weiteren Verwandten konzentrierte. Wackernells Vater Wilhelm hatte gleich nach dem Ersten Weltkrieg am Turiner Politecnico Elektrotechnik studiert und sich dann beruflich in Südtirol etabliert, wo er über lange Jahre die E-Zentrale in Forst bei Algund betreute. Zu seinen wichtigsten Projekten zählte die Realisierung der Hochspannungsleitung von der Forster Zentrale über den Jaufenpass nach Sterzing. Sein familiärer Hintergrund ist schon insofern interessant, als er eine Erklärung für eine dezidiert liberale Haltung in allen Lebenslagen liefert. Die Vorfahren der Wackernells lebten als Teil einer evangelischen Enklave in Zell am Ziller und flüchteten infolge der Gegenreformation in das Unterengadin. Sie nahmen dabei die Bäume und Fruchtäste jener Kornel-Kirsche mit, die sie bereits in Zell angebaut hatten. Die angestammte Engadiner Bevölkerung bezeichnete das neue Siedlungsgebiet der Salzburger als „Val Cornel“. Daraus entwickelte sich der Familienname Wackernell. Viele der zahlreichen Nachkommen der Großfamilie wanderten im Lauf der Zeit aus dem Engadin ab. Ein Zweig ließ sich im Oberinntal nieder, wo man aus der Kornel-Kirsche weiterhin Marmelade und Schnaps herstellte. Über das Inntal gelangten die mittlerweile zum Katholizismus konvertierten Vorfahren nach Meran. Norbert Wackernells Großvater mütterlicherseits hatte Maria Pasoldi aus Branzoll geheiratet. Die Pasoldis waren bereits vor 1918 zweisprachig, da es in Branzoll schon unter Österreich eine zweisprachige Schule gab. Wackernell erinnerte sich, seine Großmutter habe im Geschäft perfekt zweisprachig mit den Kunden kommunizieren können und auch der Großvater habe von ihr leidlich gut Italienisch gelernt. Der zeitlebens offene und unverkrampfte Umgang Wackernells mit der italienischsprachigen Bevölkerung erklärt sich wohl auch durch diesen Aspekt der Familiengeschichte. Aber nicht nur in dieser Hinsicht stand Wackernell deutlich in einer urban-liberalen Tradition. Angesichts des Umstandes, dass die Kirche in Südtirol unter dem Faschismus nochmals einen Bedeutungszuwachs erfuhr, nimmt sich der Lebenswandel seiner Familie ausgesprochen liberal aus. Bereits sein Großvater, so stellte Wackernell süffisant fest, habe sich sonntags ausschließlich zur Kirche begeben, um dort seine Freundinnen zu einem Spaziergang abzuholen. Dem Gottesdienst blieb er stets fern. Ausgesprochen laizistisch waren auch die Eltern. Sie praktizierten nicht. Der Vater habe zu ihm einmal lakonisch gemeint, er meide die Kirche, denn auf dem Friedhof liege er schließlich noch lange genug. Außerdem betonte Wackernell, er sei unter seinen Schulfreunden der einzige Nicht-Ministrant gewesen. Die Ministrantenkleidung überzustreifen hätte er als beengend empfunden. Das Freigeistige war schon damals ein Wesenszug des angehenden Ingenieurs, der sich auch im Erwachsenenleben immer wieder zeigen sollte. Fehlte es dem kleinen Norbert nie an elterlicher Zuneigung – die vom Vater geschossenen Bilder bringen das klar zum Ausdruck –, so fehlte es ihm auch materiell kaum an etwas. Bereits im Vorschulalter erfreute er sich an anspruchsvollem Spielzeug und besaß eine Reihe von Kinderbüchern. Bewegung kam in diese beschauliche Kindheit, als Norbert 1933 eingeschult wurde. Die in der Zwischenzeit vollkommen italianisierte Schule barg für viele Zeitgenossen traumatische Erfahrungen. Und auch für Wackernell verlief die Anfangsphase seiner Schullaufbahn mit kleineren Reibereien. So erschien er einmal mit Lederhosen im Unterricht. Sofort schickte ihn die Lehrerin mit dem Hinweis „Coi pantaloni sporchi non vieni più a scuola!“ nach Hause. Solche Episoden stellten aber die Ausnahme dar und auch die sprachlichen Schwierigkeiten überwand der kleine Norbert rasch. Zum einen standen die Eltern der Zweisprachigkeit konstruktiv gegenüber, zum anderen profitierte er vom Umstand gemischter Klassen. Zu seinen Schulfreunden zählte er von Beginn an etliche Italiener, die das Lernen des Italienischen außerordentlich beschleunigt hätten. Bereits ab der zweiten Klasse hatte er keinerlei Probleme mehr, dem Unterricht zu folgen, und es gelang ihm, sich zunehmend aktiv einzubringen. Wackernell lobte rückblickend seine Grundschullehrer ausdrücklich: Ab der dritten Klasse seien mit Dalbosco und Giuliani außerordentlich kompetente und motivierte Lehrpersonen am Pult gestanden, die sich auch nie faschistisch gebärdet hätten. Nach den fünf Jahren Volksschule entschied sich Wackernell für das Humanistische Gymnasium, das er bis zum Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1943 besuchte. Diese Schule durfte er als deutschsprachiger Südtiroler jedoch nicht mehr weiter frequentieren. Damit begann für den 16-Jährigen eine der turbulentesten Phasen seines Lebens. Bereits in den 1930er-Jahren bekam seine Familie die zunehmende Aggressivität des faschistischen Regimes zu spüren. Der beruflich gut positionierte, politisch uninteressierte Vater wurde aufgrund seiner Weigerung, in die Partei einzutreten, 1930 kurzfristig entlassen und blieb zwei Jahre ohne Arbeit. Not litt die Familie aufgrund des gut gehenden Ladens des Großvaters dennoch nicht, doch drückte die Situation unweigerlich auf die Stimmung in der Familie. Wackernell erinnerte sich lebhaft daran, wie der Vater nach seinem Parteieintritt zu Hause auftauchte und sich zur Belustigung von Mutter und Sohn im vollen faschistischen Ornat vom Fez bis zu den Stiefeln präsentierte. Wackernells Großmutter mütterlicherseits war nach dem Ersten Weltkrieg an der Spanischen Grippe verstorben. Einige Jahre später verkaufte der betagte Großvater das Geschäft sowie ein angrenzendes Haus, um auf dem am Zenoberg erworbenen Grundstück die heutige Villa Norbert zu bauen, die für Wackernell bis zum Umzug nach Bozen in den 1950er-Jahren das Zuhause sein sollte und die er später als Zweitwohnsitz nützte.