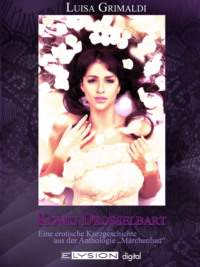Loe raamatut: «König Drosselbart»
ORIGINALAUSGABE
© 2012 BY ELYSION BOOKS GMBH, GELSENKIRCHEN
ALL RIGHTS RESERVED
UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert
FOTO: © Fotolia/ Maksim Toome
FRONTISPIZ: Hanspeter Ludwig
eISBN 978-3-945163-47-4
Inhalt
König Drosselbart
Lesen Sie weiter
König
Drosselbart
Alle viere von sich gestreckt lag Mia auf dem Bett und starrte an die Zimmerdecke. Um sie herum verteilt waren Blätter, manche noch glatt, die meisten schon zerknüllt. Die letzte Tinte sickerte aus dem umgestoßenen Fläschchen zwischen die Ritzen der Fußbodendielen neben dem Bett. Die Feder war zerknickt und zerrupft. Mia hatte ihr den Garaus gemacht, der dummen Feder, aus der so gar nichts Gutes fließen wollte. Nicht seit Tagen. Nicht seit Wochen.
Sie hob die Hände, um sie zu betrachten. Das Blau klebte an ihren Fingern und unter den Nägeln. Ihr Vater mochte es nicht, wenn sie solche Finger hatte. Mia selbst störte es überhaupt nicht, war es doch für gewöhnlich das Zeichen dessen, was sie schuf – in schlaflosen Nächten und an gedankenverlorenen Tagen. Auch jetzt waren die Nächte schlaflos und die Tage gedankenverloren, doch auf so abscheuliche Weise, dass es ihr Schmerzen bereitete, die bis in ihre Haarwurzeln und die Zehenspitzen drangen. Das einzig wirksame Mittel gegen diese Art von Pein waren Worte, ihre Worte, doch was auch immer sie nun zu Papier brachte, fühlte sich an, wie der Versuch eines Stummen zu sprechen. Keineswegs war es etwas, das auf einer Bühne vorgetragen werden sollte. Nicht einmal annähernd. Nicht einmal Teile davon. Nicht in hundert oder tausend Jahren.
Schuld an allem trug die Muse, dieses flatterhafte Wesen. Die Muse war einfach davon geflattert. Und seitdem konnte Mia nicht nur nicht mehr schreiben, sondern auch nicht mehr essen oder schlafen. Schlief sie doch, dann träumte sie von vergeblichen Versuchen, die Muse zu finden.
Man bezeichnet Mia als hübsch, doch hübsch fand sie sich selbst nicht mehr. Ihr sonst in seinem Rot strahlendes Haar hatte seine Kraft verloren und hing müde über ihre Schultern. Das Blau ihrer Augen war matt und durch nichts zum Leuchten zu bringen. Ihre helle Haut wirkte fahl – als wich das Leben mit jedem Tag ein bisschen mehr aus ihr.
Mia legte die Arme hinter den Kopf und heftete den Blick erneut auf die Zimmerdecke. Vierunddreißig Tage und Nächte war es nun her. Vierunddreißig kleine Briefe fehlten. Vierunddreißig mal Guten Morgen, mein Herz.
Ihr Herz, das hatte die Muse offenbar nicht entbehren können und mitgenommen, denn wo es einst gewesen war, saß nun ein Klumpen, der kalt vor sich hin pumpte und sie zum Atmen zwang, obwohl sie doch am liebsten damit aufgehört hätte. Welchen Sinn machte es noch zu atmen, wenn ihre Muse – er – nicht mehr da war? Wenn er keine kleinen Briefe mehr schrieb und sich nicht mehr heimlich zu ihr stahl, um Küsse auf ihrer Haut auszusäen? Seine Gegenwart, sein Anblick, seine Zeilen – das alles war zu ihrer Atemluft geworden und auch zur Nahrung ihrer Fantasie. Still und heimlich hatte er sich eingeschlichen, sie immer mehr für sich beansprucht, auf die ihm so eigene charmante Weise. In etwas mehr als zwei Jahren war er ein Teil von ihr geworden, und sie von ihm, doch bevor er sich dies eingestanden hatte, war er lieber verschwunden. Und der zuvor nie belegte Platz, den er eingenommen hatte, der Platz, von dessen Existenz Mia vor ihm nicht einmal gewusst hatte, der war nun leer. Die von ihm ausgehende Leere hatte sich wie Gift in ihr ausgebreitet.
Sie wollte ihn verabscheuen. Für seine Feigheit. Für seine Angst um verlorene Freiheit. Für seine Lügen. Dafür, dass er sie glauben gemacht hatte, die eine Besondere zu sein, die Einzige und die Einzigartige. Die hatte sie sein wollen, doch die war sie nicht gewesen. Sie wollte ihn verabscheuen, dafür, dass er ihr die Idee ins Hirn gepflanzt hatte, mit ihm durchzubrennen, um nicht Irgendeinen heiraten zu müssen, wie es ihr Vater seit einer Weile verlangte. Sie wollte ihn verabscheuen, dafür dass er ihr später gesagt hatte, sie würde sich schon damit abfinden, die Frau von Irgendeinem zu sein, wo es doch nicht bedeutete, dass sie einander nicht mehr sehen konnten. Sie wollte ihn verabscheuen für die Blässe, die sich um seine Nase gezeigt hatte, als sie ihm gestanden hatte, dass sie lieber sterben wollte, als die Frau eines anderen zu werden. Eine Wahrheit, für die sie ihn verloren hatte. So einfach hatte er sie verlassen, mit ein paar simplen kühlen Worten und ohne sich davor zu fürchten, sie zu vermissen. Sie wollte ihn verabscheuen … ihn noch lieber vergessen, ihn nicht mehr vermissen. Doch nichts davon gelang ihr. Nicht seit 34 Tagen und Nächten.
Von alldem ahnte ihr Vater natürlich nichts. Ihre Niedergeschlagenheit schrieb er ihrem Unvermögen zu schreiben zu – das er prinzipiell sogar begrüßte, denn natürlich missfiel es ihm als König, dass seine Tochter Theaterstücke verfasste und unter dem Namen eines Mannes veröffentlichte, statt sich endlich Wichtigerem zuzuwenden. Der Wahl eines Ehemanns nämlich.
Seit Wochen schon gingen die Freier in der Burg ein und aus. Sie brachten Geschenke, die Mia nicht wollte, trugen Reime vor, die sie grauenvoll fand, und überschlugen sich vor lauter Gelöbnissen, die sie langweilten. Zum Teufel mit all den öden Prinzen und Königen! Zum Teufel, ja dahin hatte sie erst gestern zwei geschickt. Entsetzlich einfältige Pinsel waren das gewesen.
Der eine dürr wie ein Bohnenstock – und dürr war auch sein Verstand. Als sie ihm die Frage gestellt hatte, warum er sie gern zur Königin nehmen wollte, hatte er zu stottern begonnen und ihren Liebreiz gelobt.
Ihren Liebreiz? Ihren Liebreiz!
Dass sie gerade alles andere als liebreizend war, hatte er gleich darauf erfahren, da sie ihn mit einem Heupferd verglichen hatte.
Der andere, der hatte sie von oben herab gemustert, obwohl er doch unter ihr stand. Offenbar wollte er sich nicht von der Schärfe ihrer Zunge beeindrucken lassen und ihr stattdessen befehlen, seine Gemahlin zu werden. Das alles wäre nicht komisch gewesen, hätte er nicht gelispelt. Seinen Sprachfehler aufgreifend, hatte Mia ihm eine Absage erteilt, die ihn vor Zorn hochrot hatte anlaufen lassen. Aus dem Saal stolzierend, hatte er ihrem Vater den Krieg erklärt, diese Ankündigung im Laufe des Tages und möglicherweise nach Abzählung seiner Soldaten jedoch zurückgezogen.
Und heute? Heute wurde schon wieder einer erwartet, der wagemutig genug war, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Sie musste also ein Bad nehmen, frisiert und gepudert werden. Für nichts und wieder nichts war dieser ganze Aufwand, denn auch diesen Prinz oder König oder Graf oder Herzog oder weiß der Geier was er war würde sie davonjagen. Folglich konnte sie ebenso gut liegen bleiben und sich in ihrem Elend suhlen.
Als habe die Zofe ihre Gedanken erraten, klopfte sie an und trat ins Zimmer. Munter vor sich hin schwatzend – in der Hoffnung, ihre gute Laune sei ansteckend – schleppte sie den Eimer heißen Wassers zum Zuber, kippte ihn aus und versprach, gleich zurück zu sein. Mia rollte sich im Bett herum, zog ein Kissen über ihren Kopf und stand erst auf, als die Zofe damit drohte, ihren Vater zu holen.
König Soundso aus Dortunddort war es, der ihr diesmal den Hof machte. Wen interessierte schon, wer er war und woher er kam? Ihren Vater vielleicht, der nach seiner Predigt über den für seine Güte bekannten Regenten nun mit angehaltenem Atem neben ihr saß und darauf hoffte, dass sie ein freundliches Wort fand.
Widerwillig wandte Mia dem Wartenden den Kopf zu und nickte zum Zeichen, dass er sprechen sollte. Wen interessierte schon, was er zu sagen hatte?
»Prinzessin Mia«, begann er, und sie konnte nicht sagen, dass er eine unschöne Stimme hatte. Nein, sie war wohlklingend und eine gewisse Wärme schwang darin mit. »Ich könnte Euch Edelsteine schenken, doch die werdet Ihr mir vor die Füße werfen. Ich könnte Löwen für Euch tanzen lassen, doch dafür würdet Ihr mich auslachen.«
Mia runzelte die Stirn. Was erzählte er da? Und wieso funkelte es in seinen dunklen Augen. War das Amüsement? Machte er sich über sie lustig? Überhaupt sah er gewitzt aus, attraktiv zwar, doch da war etwas an ihm, das sie an einen Narren erinnerte.
»Ich könnte Euch ein Schlösschen in die Mitte eines Sees bauen«, fuhr er fort. »Doch Ihr würdet behaupten, schon eines Euer Eigen zu nennen. Rubine und Diamanten, Schmuck, ein Schlösschen im See, Rösser jeder Züchtung, vergoldete Kutschen … all das habt Ihr schon.« Er legte eine Pause ein, hielt ihren Blick fest in seinem. »Und ohnehin bin ich kein Mensch, der solche Geschenke macht.«
Mia hörte, wie ihr Vater einem Atemzug wagte, einen sehr scharfen jedoch. Aber noch würde sie dem Neuen keine Absage erteilen, denn seine Worte waren nicht das allgemeine Gewäsch und stimmten sie neugierig. Sie hörte ihm gern zu, und sie sah ihn auch gern an. Sein Gewand war dunkelblau und für einen König außergewöhnlich schlicht, ganz so, als hätte er aufwendige Kleidung nicht nötig. Zugegeben hatte er das tatsächlich nicht, denn seine hochgewachsene und schlanke Statur war wohl sogar im Gewand eines Bettlers eindrucksvoll.
»Was ich Euch schenken möchte, ist meine ungeteilte Aufmerksamkeit, meine Treue, mein Lachen und manchmal auch mein Weinen, mein Herz …«
»Schweigt!« Mia erhob sich von ihrem Platz neben dem Thron ihres Vaters. Die Hände zu Fäusten geballt, starrte sie auf den augenblicklich verstummten Mann herab. »Kein weiteres Wort!
Sein Herz wollte er ihr schenken, höhnte sie im Stillen. Sie wollte sein Herz nicht. Ihr eigenes wollte sie zurückhaben, doch das konnte er ihr nicht geben. Augenblicklich setzte der altbekannte Schmerz ein, der für eine kleine Weile vergessen gewesen war, und zehrte an ihr, nagte und stach.
»Was soll ich mit solchen Gaben?«, spottete sie in einem Tonfall, den jeder am Hof in der letzten Zeit oft gehört hatte. Ihr Vater räusperte sich, als wolle er sie warnen, doch das war ihr egal. »Ich will es nicht, Euer Herz! Und Euch will ich auch nicht! Schaut Euch nur an!« Ja, betrachtete sie ihn recht, dann war seine Nase nicht ganz gerade und dieser lächerliche Bart, der gab ihm das Aussehen einer … einer …
Sie lachte, obwohl ihr nicht zum Lachen zumute war. »Ihr habt den Bart einer Drossel. Wie war Euer Name doch gleich, König Drosselbart?«
Augenblicklich verfinsterte sich die Miene des Mannes. Sein eigentlich attraktiver Mund wurde ein Strich, und seine so gewitzten dunklen Augen verengten sich zu Schlitzen unter den zusammengezogenen Brauen. Für einen Moment schien es, als wolle er noch etwas sagen, aber er ließ seine schöne Stimme nicht mehr sprechen, sondern wandte sich um, gab seinen Knappen ein Zeichen und ging ihnen voran aus dem Saal.
Auch der König war aufgestanden und wollte ihn zurückrufen. Er unterließ es, weil er doch die Erfahrung gemacht hatte, wie sinnlos es war. Sobald sich die Tür des Saals hinter den Besuchern geschlossen hatte, fuhr der König zu Mia herum. Auch seine Miene war nun düster.
»So wahr ich König über dieses Land bin«, grollte er. »Dies war der letzte Freier, den du in die Flucht geschlagen hast. Der nächstbeste, der sich um deine Gunst bemüht, sei es ein Edelmann oder ein Bettler, dem gebe ich dich zur Frau.« Damit stieg er die Stufen hinab, um sich zurückzuziehen. Den Narren, der ihn auf dem Weg mit ein paar flachen Scherzen aufzuheitern versuchte, brachte er mit einer einzigen unwirschen Geste zum Schweigen.
Tasuta katkend on lõppenud.