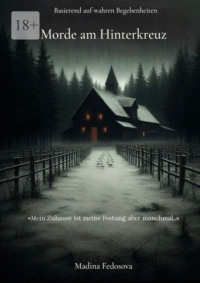Loe raamatut: «Morde am Hinterkreuz», lehekülg 3
Die Lage von Hinterkaifeck war relativ abgelegen. Bis zu den nächsten Häusern war es eine ordentliche Entfernung und bis zum Dorf Groben selbst waren es mehrere Kilometer. Aufgrund der Abgeschiedenheit war die Farm ziemlich isoliert von der Außenwelt. Eine schmale unbefestigte Straße, umgeben von Wald, führte zur Farm. Dies schuf ein Gefühl der Abgeschiedenheit von der Außenwelt, was bei den tragischen Ereignissen im Frühjahr 1922 eine verhängnisvolle Rolle spielte. Die Farm lag abseits von belebten Hauptstraßen und Verkehrswegen, was den Zugang zu ihr erschwerte und sie verwundbar machte.
Die Farm selbst, wenn Sie sie in jenen letzten friedlichen Tagen hätten sehen können, war ein riesiges, strenges Steingebäude, das in seiner Form an ein riesiges lateinisches “I” (El) erinnerte. Die Wohnräume, geräumig und wahrscheinlich gut eingerichtet, machten den Hauptteil des Hauses aus, während der Stall und die Scheune unter einem Dach an sie angrenzten. So befand sich alles, was zum Leben und Arbeiten auf der Farm benötigt wurde, unter einem Dach, in enger Verflechtung. Dies, kombiniert mit der Abgeschiedenheit der Farm, schuf eine Atmosphäre der Autarkie und Abgeschlossenheit.
Draußen, im großen offenen Hof, der mit groben Steinplatten gepflastert war, herrschte Ordnung. Auf der linken Seite stand separat ein kleiner Schuppen, der gleichzeitig als Bäckerei und Waschküche diente. Sein Schornstein ragte über das Dach hinaus und verbreitete den Duft von frisch gebackenem Brot, der jedoch nie wieder im Haus zu riechen war. Auf dem Hof, der an das Hauptgebäude angrenzte, befanden sich Schuppen zur Lagerung von Heu sowie Gehege für das Vieh, die ein für den Bauernhof typisches Bild ergaben. Alles war an seinem Platz, vertraut und ruhig.
Und doch, trotz der scheinbaren Zuverlässigkeit und Solidität, strahlte Hinterkaifeck eine gewisse Düsternis aus, als ob es ein unausgesprochenes Geheimnis barg. An stillen Abenden, wenn die Sonne hinter dem Horizont versank und der Wald von einem dichten Schatten umhüllt wurde, schien es, als ob sich die Mauern der Farm zusammenziehen und sich in den dunklen Ecken unsichtbare Beobachter verstecken würden.
Besonders unheilvoll wirkte der Dachboden. Knarrende Dielen, das Flüstern des Windes in den Ritzen und die bizarren Schatten, die das Mondlicht warf, erzeugten das Gefühl, dass dort etwas Unsichtbares und Unfreundliches hauste. Manchmal waren von dort nachts seltsame Geräusche zu hören – entweder ein Rascheln oder ein Knirschen, das das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Und obwohl sich die Familie Gruber an diese düstere Atmosphäre gewöhnt hatte und gelernt hatte, die seltsamen Geräusche zu ignorieren, lauerte tief im Inneren jedes einzelnen eine unerklärliche Angst. Angst vor der Dunkelheit, vor dem Wald, vor dem, was sich im Schatten verbirgt.
Hinterkaifeck schien auf etwas zu warten. Auf seine Stunde, um sein schreckliches Geheimnis zu enthüllen. Und diese Stunde rückte mit jeder Minute näher, mit jedem Knarren der Dielen, mit jedem Rascheln im Wald.
Kapitel 5
Das Haus, in dem das Licht erlischt
Die Farm Hinterkaifeck, versunken in der bayerischen Einöde, gehörte der Familie Gruber. Man sagte, sie lebten im Wohlstand – der Boden sei fruchtbar, das Vieh gepflegt. Aber Geld, das ist bekannt, garantiert nicht immer Frieden.
Die Grubers erfreuten sich nicht der Zuneigung ihrer Nachbarn. Sie lebten zurückgezogen, als ob sie ein Geheimnis hüteten, und das erregt immer Misstrauen. Sie wurden gemieden, hinter ihrem Rücken wurde getuschelt, sie wurden als seltsam, sogar sündhaft bezeichnet. Als ob ein alter Fluch auf der Farm lastete.
Es gibt nur wenige Dokumente über die Grubers, die Erinnerungen sind vage und die Gerüchte… die Gerüchte sind in düsteren Farben gehalten. Man spürte, dass in diesem Haus etwas nicht stimmte, dass sich hinter der äußeren Anständigkeit etwas Dunkles verbarg. Als ob sich hinter den verschlossenen Türen von Hinterkaifeck ein eigenes unheilvolles Drama abspielte, von dem niemand erfahren sollte.
Die Grubers lebten wie in einer belagerten Festung und schotteten sich nicht nur durch die steinernen Mauern der Farm, sondern auch durch eine unsichtbare Mauer der Entfremdung von der Welt ab. Nur selten sah man sie auf Dorffesten oder in der Kirche, sie teilten weder Freuden noch Leiden mit ihren Nachbarn. Und die Nachbarn waren, ehrlich gesagt, auch nicht besonders an einer Kontaktaufnahme interessiert und versuchten, sich nur im Notfall an sie zu wenden. Als ob sie spürten, dass in Hinterkaifeck etwas Unheilvolles in der Luft lag, dass man sich besser von diesem Ort fernhalten sollte.
Die einzige Ausnahme war Viktoria, die Tochter von Cäcilia und Andreas. Dieses große, schlanke Mädchen mied im Gegensatz zu ihren Eltern nicht die Außenwelt. Sie war der Faden, der Hinterkaifeck mit den umliegenden Dörfern verband. Viktoria ging in Weidhofen zur Schule, wo sie, wenn auch widerwillig, mit anderen Kindern und Lehrern verkehrte. Diese wenigen Stunden fernab der Farm waren für sie ein Hauch frischer Luft, eine seltene Gelegenheit, sich als Teil des normalen Lebens zu fühlen.
Auf dem Weg zur Schule und manchmal auch bei Besorgungen wechselte Viktoria manchmal ein paar Worte mit dem Postboten oder vorbeikommenden Händlern. Diese Gespräche waren kurz und förmlich, aber selbst sie dienten als dünner Faden, der sie mit der Außenwelt verband und sie daran erinnerte, dass sie nicht ganz vergessen war. Hilfe auf dem Hof und seltene Besuche von Gottesdiensten gaben ihr ebenfalls die Möglichkeit, der bedrückenden Atmosphäre des Hauses zumindest kurzzeitig zu entfliehen.
Über Viktoria wurde hauptsächlich Gutes berichtet – ein liebes, ruhiges Mädchen mit einer schönen Stimme. Sie war ein hübsches Mädchen, aber in ihrem Aussehen war eine seltsame Distanziertheit zu spüren. Es schien, als ob sie in ihrer eigenen Welt lebte und sich von der grausamen Realität, die sie umgab, abgeschottet hatte.
Man sagte, dass ihr Engelsgesang im Kirchenchor die Sünden sühnte, die in den Mauern der Farm begangen wurden. Aber selbst in der Kirche, an einem heiligen Ort, konnte Viktoria sich nicht völlig entspannen, als ob sie Angst hätte, dass der Schatten von Andreas sie auch dort einholen würde. Sie fürchtete ihren Vater wie das Feuer, widersprach ihm nie, vermied seinen Blick und führte widerspruchslos alle seine Befehle aus. Aber selbst das bewahrte sie nicht vor seinem Zorn – blaue Flecken, die sorgfältig unter der Kleidung versteckt waren, waren ein beredtes Zeugnis der Grausamkeit, die in Hinterkaifeck herrschte. Viktoria war nicht das einzige Kind von Cäcilia, aber von allen Kindern erreichte nur sie das Erwachsenenalter. Die ältere Schwester heiratete und zog weg, da sie das Leben an diesem verfluchten Ort nicht ertragen konnte, und ließ Viktoria allein mit ihrer Angst zurück.
Und so lebte sie, 27 Jahre alt, zerbrechlich und gebrochen, weiterhin in einem Haus, in dem Grausamkeit und Gewalt herrschten, und träumte von einer Rettung, die nie kam… Ihr Haus war eher eine Hölle, und es gab kaum Hoffnung, dass sie dieser Hölle entkommen würde.
Die Meinungen der Nachbarn gingen oft auseinander mit dem, was die Grubers selbst sahen. Und einer von denen, die diese Familie seit vielen Jahren kannten, war Kurt Wagner, der auf einer benachbarten Farm lebte:
Zeugenaussage von Kurt Wagner:
Er lebte auf einer benachbarten Farm und kannte die Familie Gruber seit vielen Jahren. Er hinterließ schwere Erinnerungen an Andreas Gruber und die Lebensbedingungen der Kinder. In seiner Aussage gab er an, dass seiner Meinung nach das Kind wahrscheinlich aufgrund mangelnder Pflege und unzureichender Ernährung gestorben sei. Wagner behauptete auch, dass er und sein Vater oft gehört hätten, wie die Kinder tagelang im Keller eingesperrt wurden, wenn sie an der Farm vorbeigingen. Abschließend fügte er hinzu: “Ich sage Ihnen ganz offen, diese Leute waren nicht gut.”
Bisher sind nur wenige Informationen über sie erhalten geblieben, als ob die Zeit und das menschliche Gedächtnis versucht hätten, ihre Namen vom Angesicht der Erde zu tilgen. Und die wenigen Informationen, die uns erreicht haben, sind größtenteils negativ gefärbt. Es scheint, als ob die Geschichte selbst versucht, uns zu warnen, indem sie davon spricht, dass sich hinter dieser wohlhabenden Fassade etwas Schreckliches verbarg.
Zeugenaussage von Hermann Bauer:
In einer im Jahr 1922 bei der Polizei eingereichten Erklärung behauptete Hermann Bauer, ein lokaler Bauer, der zeitweise mit Andreas Gruber zusammenarbeitete, Folgendes: “Die Grubers waren sehr fleißig und sparsam. Sie führten ein zurückgezogenes Leben und vermieden, wenn möglich, jeden Kontakt mit anderen Menschen.” Bauer fügte hinzu, dass die Familie Gruber trotz der durch den Krieg, den Hunger, die Hyperinflation und die politische Instabilität verursachten schweren Zeiten hart arbeitete, um ihren Hof zu erhalten.
Dieser lakonische Bericht, frei von Emotionen und persönlichen Einschätzungen, vermittelte dennoch einen Eindruck von der Familie Gruber. Sie waren fleißig und sparsam, aber gleichzeitig äußerst zurückgezogen und distanziert von der Welt um sie herum. Ihr Lebensstil war möglicherweise durch die schwierigen Umstände der Zeit bedingt, könnte aber auch auf mehr hindeuten – auf verborgene Motive, Geheimnisse und Ängste.
Die Geschichte der Farm Hinterkaifeck begann lange vor den tragischen Ereignissen des Jahres 1922. Ursprünglich gehörte dieses Land Josef Azam, dem ersten Ehemann von Cäcilia Gruber. Er war es, der mit seiner Arbeit und Ausdauer das verlassene Land in einen blühenden Betrieb verwandelte. Er baute ein gutes Haus, schaffte Vieh an und begann, die Felder zu bestellen. Hinterkaifeck wurde zum Lebenswerk, zur Verkörperung seines Traums von einem ruhigen und friedlichen Winkel, in dem er mit seiner Familie leben konnte.
Doch das Schicksal beschloss anders. Josef Azam starb und hinterließ Cäcilia als Witwe mit einer kleinen Tochter auf den Armen. Und dann trat Andreas Gruber in ihr Leben, ein starker und herrischer Mann, der ihr die Hand und das Herz anbot. Cäcilia, die Schutz und Unterstützung brauchte, willigte ein, ihn zu heiraten, und so ging die Farm Hinterkaifeck in den Besitz der Familie Gruber über.
Indem ich Informationen, Zeugnisse und Archivdaten untersuche, werde ich versuchen, vollständigere Porträts jedes Mitglieds der Familie Gruber zu erstellen und zu versuchen, über die trockenen Fakten hinauszugehen und in ihnen lebende Menschen mit ihren Hoffnungen, Ängsten und Geheimnissen zu sehen.
Andreas Gruber:
Andreas Gruber… Schon sein Name klang rau und schroff, wie das Knirschen von Kies unter den Füßen. Der Eigentümer von Hinterkaifeck, ein harter und wortkarger Mann, war mit seinen noch nicht ganz sechzig Jahren die Verkörperung des unfreundlichen Bodens, den er bewirtschaftete. Sein Gesicht, das von tiefen Falten zerfurcht war, schien aus Stein gemeißelt zu sein, und seine Augen, grau und kalt wie der Winterhimmel, drückten selten etwas anderes als Unzufriedenheit aus.
Er war immer in dunkle, abgenutzte Kleidung gekleidet und schien mit der Landschaft zu verschmelzen, indem er zu einem untrennbaren Teil der düsteren Farm wurde. Man sagte, er sei fleißig gewesen und sei von morgens bis abends auf dem Feld oder im Stall verschwunden.
Aber dieser Fleiß war eher erzwungen als tugendhaft – die Erde gab nur widerwillig Ernte, das Vieh war oft krank, und jeden Tag musste man ums Überleben kämpfen. Und vielleicht war es dieser ständige Kampf, der sein Herz verbitterte, ihn so menschenscheu und misstrauisch machte.
Es gab aber auch andere Gerüchte… Man tuschelte über seine Grausamkeit, darüber, wie er seine Frau und seine Tochter behandelte, über seine Wutausbrüche, von denen die Mauern von Hinterkaifeck erzitterten.
Ob das wahr ist oder nicht, lässt sich heute nicht mehr feststellen, aber eines ist sicher: Andreas Gruber war kein einfacher Mensch, in dem sich ein dunkles und unheilvolles Geheimnis verbarg.
Der Schatten der Tragödie hing wie ein schwarzer Flügel über der Familie Gruber, lange vor den Ereignissen in Hinterkaifeck. Das zweite Kind von Andreas, das in seiner ersten, kurzen Ehe geboren wurde, starb im Alter von zwei Jahren.
Die Umstände dieses Todes, die schon traurig genug waren, wurden von einem dichten Nebel aus Gerüchten und Spekulationen umhüllt, die sich im Laufe der Zeit zu etwas Unheilvollem entwickelten. Als offizielle Todesursache wurde eine Krankheit angegeben, ein schnell verlaufendes Fieber, das das Leben des Kindes forderte.
Aber in den stillen bayerischen Dörfern, wo sich der Klatsch schneller als der Wind verbreitet, sagte man etwas ganz anderes. Man tuschelte, dass Andreas am Tod des Kindes beteiligt gewesen sei, dass er zu streng mit ihm gewesen sei, dass er es nicht ausreichend versorgt habe.
Die einen sprachen von einem Unfall, die anderen von einem vorsätzlichen Mord. Sogar Motive wurden genannt: ein ungewolltes Kind, ein Hindernis im Leben, eine Last, die man loswerden musste.
Beweise für diese ungeheuerlichen Anschuldigungen gab es natürlich nicht. Aber selbst das Fehlen von Beweisen konnte nicht das bedrückende Gefühl zerstreuen, dass der Tod des Kindes mehr war als nur ein tragischer Zufall.
Trotz der schwierigen Zeiten war Andreas ein recht wohlhabender Bauer. Er misstraute den Banken und erinnerte sich an vergangene Zusammenbrüche und Hyperinflation. Alle seine Ersparnisse – Goldmünzen und Banknoten – bewahrte er zu Hause auf, was viele in der Gegend wussten.
Andreas war laut Aussage der Nachbarn ein grober, mürrischer und jähzorniger Mensch. Er verstand sich aufgrund seines schlechten Charakters mit niemandem. Er geriet wiederholt in betrunkene Schlägereien und allerlei Schwierigkeiten und scheute sich nicht, Gewalt anzuwenden. Bei jeder bissigen Bemerkung gegen ihn explodierte er und drohte, den Täter zu erschlagen.
Zu Hause verwandelte er sich in einen wahren Tyrannen, der alle Haushaltsmitglieder für die geringste Verfehlung bestrafte. Er erhob nicht selten die Hand gegen seine Frau und Tochter.
Deshalb mieden ihn die Dorfbewohner und wollten sich nicht mit ihm anlegen und zogen es vor, die Farm Hinterkaifeck zu umgehen. Sie wussten, dass Andreas Gruber ein gefährlicher und unberechenbarer Mensch war, und es war besser, sich nicht mit ihm anzulegen.
Er war ein Fremder unter Seinesgleichen, ein einsamer und verbitterter Mensch, der bereit war, seinen Zorn an den Nächsten und Wehrlosesten auszulassen.
Es ist bekannt, dass er zweimal verheiratet war. Über die erste Frau ist fast nichts bekannt, ihr Name ist aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. Man sagt, sie sei unter mysteriösen Umständen gestorben, aber diese Gerüchte wurden nie bestätigt. Durch die Heirat mit Cäcilia erhielt er nicht nur eine Frau, sondern auch die Farm Hinterkaifeck, die er geschickt an sich riss. Andreas Gruber war nicht nur ein Bauer, er war der Herr seines Landes und seiner Familie.
Cäcilia Gruber:
Ein stiller Schatten im Haus Gruber. Mit ihren zweiundsiebzig Jahren wirkte sie älter als sie war. Ihr von Falten zerfurchtes Gesicht verriet ein schweres Leben voller Arbeit und Sorgen. Ihre Augen waren trüb geworden, als ob das Licht der Hoffnung in ihnen erloschen wäre. Sie kleidete sich bescheiden in dunkle Kleider und Tücher, die ihr graues Haar verbargen. Ihre Bewegungen waren langsam und vorsichtig, als ob sie Angst hätte, das fragile Gleichgewicht im Haus zu stören.
Cäcilia Sanhuber (die zukünftige Gruber) ging ihre erste Ehe mit Josef Azam von Hinterkaifeck ein. Sein Name klang zwar gewichtig, bedeutete aber keine Zugehörigkeit zum Adel. “Von Hinterkaifeck” ist kein Teil seines Nachnamens, sondern eher ein Hinweis auf seine Herkunft und den Besitz der Farm Hinterkaifeck. Damals war es in Bayern (und in anderen Teilen Deutschlands) üblich, dem Nachnamen “von” hinzuzufügen, wenn die Familie Land besaß oder adliger Herkunft war. Die Familie Azam war jedoch nicht adelig, daher deutet “von Hinterkaifeck” eher auf ihre Verbindung zu dieser bestimmten Farm hin.
Diese Ehe war nicht nur eine Verbindung zweier Herzen, sondern auch ein durch Blut und Erde besiegelter Handel. Bereits am 24. April 1877 erbte Josef Azam von seinem verwitweten Vater, Johann Azam, den Familiengrundbesitz, den Waldhof. Land ernährt und beschützt bekanntlich, und zu jener Zeit war sein Besitz eine Garantie für das Überleben.
Aber das ist noch nicht alles. Zwischen Cäcilia und Josef wurde ein notarieller Ehe- und Erbvertrag geschlossen – ein Dokument, das in trockener Rechtssprache verfasst war, aber hinter dem sich komplexe Verflechtungen von Interessen und Hoffnungen verbargen. Nach der Eheschließung wurde Cäcilia Azam Miteigentümerin dieses Grundstücks. Ein Papier, das ihr das Recht auf einen Teil dieses rauen Landes gab, ein Recht, das ihr, wie sich herausstellte, kein Glück und keine Sicherheit garantierte.
Bald verwandelte sich dieses Recht in eine schwere Last. Am 21. Mai 1885 starb Josef Azam, und Cäcilia blieb von einem Tag auf den anderen allein zurück – als Witwe und einzige Besitzerin der Farm Hinterkaifeck, auf der nun die ganze Verantwortung lastete.
Diese Last war nicht leicht, besonders für eine Frau, aber Cäcilia zerbrach nicht. Die schwere Arbeit auf der Farm, die sie Tag für Tag auslaugte, brach sie nicht körperlich, nahm ihr aber die letzten seelischen Kräfte.
Ein Jahr später, im Jahr 1886, heiratete sie zum zweiten Mal – Andreas Gruber. Was trieb sie an? Nachwirkungen der Hoffnung auf Glück, der Wunsch, eine verwandte Seele zu finden, oder einfach nur das Streben nach Stabilität in einer unruhigen Welt? Die Farm brauchte sicherlich einen starken Besitzer, und Cäcilia eine zuverlässige Stütze, einen Menschen, der die Last der Sorgen mit ihr teilte und ihr und ihren Lieben eine Zukunft sicherte. Nach der Hochzeit wurde ein Vertrag über den gemeinsamen Besitz der Farm unterzeichnet, was zu dieser Zeit üblich war – eine formelle Bestätigung der Union und der gemeinsamen Interessen.
Und doch wurde diese Ehe trotz aller Hoffnungen und Erwartungen für Cäcilia nicht zur Rettung, sondern eher zu einer Last, die sie schweigend und widerspruchslos trug. Sie war geduldig wie die Erde, die jeden Regen aufnimmt, und fügsam, ließ das Schicksal sie auf dem vorgezeichneten Weg führen. Jeden Morgen stand sie auf, wissend, dass sie nur eines erwartete: die Wiederholung des gestrigen Tages, erfüllt von Schweigen, harter Arbeit und Angst. Es schien, als ob das Schicksal schon lange alles für sie entschieden hatte, und Cäcilia akzeptierte demütig jeden Schlag, ohne auf Veränderungen zu hoffen. Sie war wie eine alte Ikone, die von Zeit und Kummer verdunkelt war, aber in der Tiefe ihrer Seele immer noch einen schwachen Hoffnungsschimmer auf das bewahrte tief in ihrer Seele einen schwachen Hoffnungsschimmer auf bessere Zeiten.
Die Frau hatte ein schweres Leben hinter sich. Gerüchten zufolge wurde sie von ihrem Vater und später von ihrem Ehemann Andreas misshandelt. Es ist heutzutage natürlich unmöglich, diese Gerüchte zu bestätigen, aber das Leben einer Bäuerin war in jenen Zeiten selten einfach und unbeschwert. Frauen arbeiteten gleichberechtigt mit den Männern, ertrugen Entbehrungen und wurden nicht selten Opfer häuslicher Gewalt.
Dennoch wäre es ein Fehler, Cäcilia für ein sanftmütiges und willenloses Opfer zu halten. Diejenigen, die im Dorf lebten, bestätigten, dass sie einen starken Charakter und einen festen Willen hatte. Sie konnte für sich und ihre Familie einstehen, auch wenn sie sich der Tyrannei ihres Mannes vielleicht nicht immer offen widersetzen konnte. Cäcilia war eine komplexe und widersprüchliche Persönlichkeit, die unter dem Einfluss schwieriger Lebensumstände geformt wurde.
Viktoria Gruber:
An einem kalten Februarmorgen des Jahres 1887, als ein heulender Wind an den kahlen Ästen der Bäume um Hinterkaifeck zerrte, gebar Cäcilia ein Mädchen. Der Eintrag im Kirchenbuch lautete: Viktoria Gruber, 6. Februar 1887.
Die Geburt war schwer und erschöpfend. Als die Hebamme das Neugeborene sorgfältig in Cäcilias Arme legte, schloss diese erschöpft die Augen.
Viktoria wurde schweigend geboren. Kein Schrei, kein Piepsen – nur ein leises Knurren, das die Hebamme stutzig machte. Andreas, der seine Gefühle normalerweise zurückhielt, stand abseits und beobachtete das Geschehen mit einem undurchdringlichen Gesicht. Sein Blick, der über die blasse Haut des Mädchens glitt, verweilte auf ihren großen, weit geöffneten Augen, als ob er versuchte, etwas in ihnen zu erkennen, das anderen verborgen blieb.
Die Jahre vergingen, aber dieser Blick voller Unausgesprochenem blieb ein Rätsel. Viktoria, die auf der Farm Hinterkaifeck aufwuchs, schien aus Widersprüchen gewoben zu sein. Ihre hochgewachsene, fast kantige Gestalt trug scheinbar eine Last, die für ihr junges Alter unzumutbar war. Ihre Bewegungen, normalerweise fließend und anmutig, wurden manchmal schroff und nervös und verrieten eine verborgene Anspannung. Ihr Gesicht, das von dunklem, dichtem Haar umrahmt wurde, wirkte blass, fast leblos, als ob ihr Blut langsamer floss als bei anderen. Ihre großen grauen Augen, die mit ihrer Schönheit hätten fesseln können, blickten nun misstrauisch in die Welt, als ob sie nach Anzeichen von Gefahr suchten. Ihr Blick war durchdringend, scharf und in der Lage, kleinste Details zu erkennen, die anderen verborgen blieben.
Sie war schweigsam und zurückhaltend und zog es vor, zu beobachten, anstatt sich zu beteiligen. Ihre Stimme klang leise, fast wie ein Flüstern, als ob sie Angst hätte, die Stille zu um keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie hatte etwas Innerliches, Abgeschlossenes an sich, als ob sie sich mit einem unsichtbaren Schild vor der Außenwelt schützte. Sie lächelte selten, und wenn sie lächelte, schien es, als ob das Lächeln ihre Augen nicht berührte, als ob es nur eine Maske war, die wahre Gefühle verbarg.
Ihre Hände, die für gewöhnlich mit schwerer Hausarbeit beschäftigt waren, zeichneten sich durch eine seltsame Anmut aus. Die Finger waren lang, dünn, als wären sie nicht für grobe Arbeit geschaffen, sondern für etwas Anmutigeres. Sie liebte es, Zeit allein zu verbringen, durch die umliegenden Wälder zu streifen, Kräuter und Blumen zu sammeln. Man sagte, sie kenne die Sprache der Pflanzen, verstehe ihre geheimen Botschaften.
Sie hatte etwas Unirdisches, etwas Jenseitiges, das gleichzeitig anzog und abstieß. Sie schien ein Rätsel zu sein, das unmöglich zu lösen war, ein Geheimnis, das man besser nicht anrühren sollte. Sie war wie eine Warnung, wie ein Zeichen, das darauf hinwies, dass es in dieser Welt Dinge gibt, die man besser nicht wissen sollte.
Sophia Gruber:
Zwei Jahre später, im Jahr 1889, ertönte im Haus erneut der Schrei eines Neugeborenen – Cäcilie brachte eine zweite Tochter zur Welt, Sophia. In den ersten Tagen war das Haus voller Freude, doch zusammen mit ihr schwebte eine unbestimmte Besorgnis in der Luft, eine unklare Vorahnung von Unglück. Sophia schien zu zerbrechlich, zu schutzlos gegenüber den dunklen Kräften, die Hinterkaifeck zu umgeben schienen.
Es war ihr nicht bestimmt, lange zu leben. Sophia verließ diese Welt im Alter von zwei Jahren, als hätte ein böser Geist ihre Seele geraubt und nur einen leblosen Körper zurückgelassen. Eine Krankheit, in Geheimnisse gehüllt, schien aus den umliegenden Wäldern herabgestiegen zu sein, verdrehte ihren zerbrechlichen Körper und raubte ihr den Atem.
Die Kindersterblichkeit wütete zu jener Zeit wie ein unersättlicher Schnitter in den bayerischen Landen, und kein Haus konnte sich in Sicherheit wiegen. Jedes neugeborene Kind kam mit dem Stigma der Verletzlichkeit zur Welt, wie ein dünner Trieb, der sich durch den steinigen Boden kämpfen musste. Und nur wenigen gelang dies. Typhus, Diphtherie, Masern, Scharlach – die Namen dieser Krankheiten klangen wie finstere Beschwörungen, die Säuglinge und Kinder zu einem qualvollen Tod verurteilten. Es gab keine Impfungen, keine wirksamen Medikamente, nur Gebete und Kräuteraufgüsse, die eher Trost als Heilung brachten. Schlechte Hygiene war allgegenwärtig: schmutziges Wasser aus Brunnen, Enge in den engen Hütten, in denen sich im Winter Menschen und Vieh versammelten, fehlendes Grundwissen über Mikroben und Infektionen. Krankheiten breiteten sich wie ein Waldbrand aus und erfassten ganze Dörfer. Mütter sahen voller Entsetzen zu, wie ihre Kinder vor ihren Augen vergingen, wie ihre Körper von Ausschlägen bedeckt wurden, wie sie von Husten erstickt wurden. Sie wischten ihnen den Schweiß von der Stirn, flüsterten Gebete, hofften auf ein Wunder, aber Wunder geschahen selten. Selbst wenn ein Kind nach einer schweren Krankheit überlebte, blieb es schwach und schutzlos gegenüber anderen Gefahren: Hunger, Mangel an warmer Kleidung, harter Arbeit, die mit fünf oder sechs Jahren begann. Viele Kinder erlebten einfach nicht das Erwachsenenalter und nahmen ihre unerfüllten Träume und unerfüllten Hoffnungen mit sich. Auf den Friedhöfen am Rande der Dörfer nahmen Kindergräber ganze Reihen ein – gesichtslose Hügel, bedeckt mit Gras und Wildblumen, eine traurige Erinnerung daran, wie zerbrechlich und kurz das Leben in jenen Tagen war.
Der Tod des Kindes war ein weiterer Schlag für Cäcilie, obwohl sie es äußerlich still und ohne Tränen ertrug. Der Verlust hinterließ sicherlich seine Spuren, aber kaum jemand bemerkte dies hinter ihrer üblichen Unterwürfigkeit und Demut. In den rauen Realitäten des Lebens auf dem Bauernhof, wo jeder Tag ein Kampf ums Überleben war, gab es einfach keinen Platz für lange Trauer. Man musste arbeiten, um zu überleben, und Cäcilie erfüllte weiterhin ihre Pflichten, als wäre nichts geschehen. Aber was in ihrer Seele vor sich ging, blieb ein Geheimnis.
Kapitel 6
Erde und Blut
1910—1914
In jenen Tagen war Land nicht nur Kapital, es war der Eckpfeiler des Lebens, die Quelle des Lebensunterhalts und des sozialen Status. Intrigen, Konflikte und Schicksale rankten sich seit jeher um den Landbesitz. Die Farm Hinterkaifeck war da keine Ausnahme.
Im Jahr 1885, als die Frage der Nachfolge auf dem Hof anstand, wurden die Dokumente auf Cäcilie Senior ausgestellt. Dies entsprach einer alten Tradition, die in bayerischen Bauernfamilien weit verbreitet war: Land wurde in der Regel in weiblicher Linie vererbt. Diese Regel existierte nicht aufgrund feministischer Überzeugungen, sondern aus pragmatischen Gründen. Es wurde angenommen, dass Frauen stärker an das Land, an die Familie, gebunden sind und daher besser in der Lage sind, die Integrität des Hofes zu wahren, ohne ihn zwischen zahlreichen männlichen Erben aufzuteilen.
Nach der Heirat von Cäcilie Senior im Jahr 1886 wurde ihr Mann Andreas Gruber naturgemäß Miteigentümer des Hofes. Das war durchaus üblich. Der Ehemann übernahm mit der Eheschließung die Verpflichtung, den Hof zu bewirtschaften, seiner Frau bei der Landbewirtschaftung zu helfen und die Familie zu versorgen. Im Gegenzug erhielt er das Recht auf einen Teil des Gewinns, ein Stimmrecht bei wichtigen Entscheidungen bezüglich des Hofes und, was nicht unerheblich war, einen gewissen sozialen Status.
Andreas Gruber war fast dreißig Jahre lang, bis 1914, Miteigentümer der Farm Hinterkaifeck. In dieser Zeit spielte er zweifellos eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Hofes, indem er Entscheidungen traf, an Feldarbeiten teilnahm und mit den Einheimischen interagierte.
Allerdings war die Arbeit auf dem Bauernhof nie einfach, und manchmal brauchte selbst eine starke Bauernfamilie Hilfe von außen. Dies galt insbesondere für die Zeiten der Aussaat und Ernte. Ohne Leiharbeiter ging es in solchen Momenten kaum.
Damals suchten viele Menschen nach Verdienstmöglichkeiten, aber bei weitem nicht jeder war bereit, sich mit dem schlechten Charakter von Andreas Gruber abzufinden. Der Hof Hinterkaifeck hatte einen schlechten Ruf, und so hielten sich die Leiharbeiter dort nicht lange auf. Sie tauchten nur für eine Saison auf, um die schwerste Arbeit zu verrichten, und beeilten sich dann, diesen unruhigen Ort zu verlassen.
In der kalten Jahreszeit, als die wichtigsten Feldarbeiten abgeschlossen waren, entfiel die Notwendigkeit von Saisonarbeitern. Die Familienmitglieder erledigten die laufenden Geschäfte selbst. Die einzige Ausnahme war das Dienstmädchen. Cäcilie konnte aufgrund ihres Alters und ihrer Krankheiten nicht mehr alle Haushaltsaufgaben selbst erledigen, daher lebte ständig eine Frau auf dem Hof, die im Haushalt half.
Nach 1914 ging das Alleineigentum auf ihre Tochter Viktoria über. Zu diesem Zeitpunkt war Viktoria bereits 35 Jahre alt. Als offizielle Besitzerin galt Viktoria Gruber, deren Schicksal man schon damals als schwierig bezeichnen konnte.
Viktoria, ein Mädchen, wie sie beschrieben wurde, bescheiden und anmutig, musste die Last des schlechten Rufs ihres Vaters Andreas tragen. Die Bewohner der Umgebung nahmen sie in erster Linie als Landbesitzerin, als “reiche Erbin”, wahr. Leider zog dies oft nicht die ehrlichsten Leute an.
Im April 1914 heiratete Viktoria Gruber, die Tochter der Hofbesitzer von Hinterkaifeck, Andreas und Cäcilie, den Bauern Klaus Briel.
Und obwohl dies auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Verbindung erschien, tuschelten viele im Dorf, dass Klaus eher von eigennützigen Motiven getrieben war. Vielleicht hoffte er, seine wackelige finanzielle Situation zu verbessern, indem er die Tochter wohlhabender Bauern heiratete. Leider waren solche Zweckehen in jenen Tagen keine Seltenheit, insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen Land und Reichtum von großer Bedeutung waren.
Einen Monat vor der Hochzeit, als ahnten Viktorias Eltern Unheil, trafen sie eine wichtige Entscheidung. Sie überschrieben ihrer Tochter das Eigentumsrecht an dem Großteil ihres Vermögens. Möglicherweise war dieser Schritt von der Sorge um Viktorias Zukunft diktiert, dem Wunsch, ihr im Falle unvorhergesehener Umstände einen gewissen Schutz zu bieten. So gingen nach der Eheschließung drei Viertel von Hinterkaifeck offiziell in den Besitz von Viktoria über, während das restliche Viertel an Klaus, ihren Mann, ging.
Klaus, wahrscheinlich von dem aufrichtigen Wunsch getrieben, eine starke Familie zu gründen und zu einem gemeinsamen Ziel beizutragen, nahm seinen neuen Status mit Begeisterung an. Er zog in das Haus seiner Frau, auf den Hof Hinterkaifeck, und krempelte die Ärmel hoch, um zum Wohle des Hofes zu arbeiten. Er arbeitete fleißig auf dem Feld, half im Haushalt und versuchte, seine Fähigkeit und Nützlichkeit zu beweisen. Wahrscheinlich wollte er sich den Respekt von Viktoria und ihren Eltern verdienen und ein vollwertiges Mitglied der Familie Gruber werden. Er glaubte naiverweise, dass Fleiß und Hingabe ihm helfen würden, ihre Herzen zu gewinnen und ein solides Fundament für eine zukünftige Ehe zu schaffen. Er wusste noch nicht, dass der wahre Grund für die Probleme nicht in seinem mangelnden Fleiß lag, sondern in den dunklen Geheimnissen, die in den Mauern des Hofes Hinterkaifeck verborgen waren.