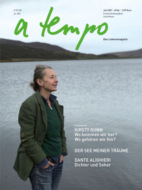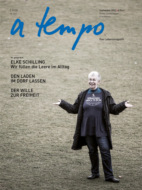Loe raamatut: «a tempo - Das Lebensmagazin»

1 – über a tempo
a tempo - Das Lebensmagazin
a tempo Das Lebensmagazin ist ein Magazin für das Leben mit der Zeit. Es weckt Aufmerksamkeit für die Momente und feinen Unterschiede, die unsere Zeit erlebenswert machen.
a tempo bringt neben Artikels rund um Bücher und Kultur Essays, Reportagen und Interviews über und mit Menschen, die ihre Lebenszeit nicht nur verbringen, sondern gestalten möchten. Die Zusammenarbeit mit guten Fotografen unterstützt hierbei den Stil des Magazins. Daher werden für die Schwerpunktstrecken Reportage und Interview auch stets individuelle Fotostrecken gemacht.
Der Name a tempo hat nicht nur einen musikalischen Bezug («a tempo», ital. für «zum Tempo zurück», ist eine Spielanweisung in der Musik, die besagt, dass ein vorher erfolgter Tempowechsel wieder aufgehoben und zum vorherigen Tempo zurückgekehrt wird), sondern deutet auch darauf hin, dass jeder Mensch sein eigenes Tempo, seine eigene Geschwindigkeit, seinen eigenen Rhythmus besitzt – und immer wieder finden muss.
2 – inhalt
3 – editorial Das schaffe ich von Jean-Claude Lin
4 – im gespräch Handeln aus Liebe zum Leben Cordula Weimann im Gespräch mit Julia Meyer-Hermann
5 – thema Fjodor Michailowitsch Dostojewskij – Unterwegs zwischen Extremen von Evelies Schmidt
6 – augenblicke Hunde fürs Leben von Claus-Peter Lieckfeld
7 – herzräume Paradiese von Brigitte Werner
8 – erlesen Karl Heinz Bohrer «Was alles so vorkommt» gelesen von Konstantin Sakkas
9 – mensch & kosmos Wie man Reife gewinnt von Wolfgang Held
10 – alltagslyrik – überall ist poesie Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von Christa Ludwig
11 – kalendarium November 2021 von Jean-Claude Lin
12 – was mich antreibt Wärme von Yaroslava Black
13 – unterwegs Vertrauen gewinnen von Daniel Seex und Jean-Claude Lin
14 – sprechstunde Der Kälte trotzen – Wärme bilden von Markus Sommer
15 – blicke groß in die geschichte «Warum nicht menschlich den Menschen sehen?» von Andre Bartoniczek
16 – von der rolle Er sitzt wie angegossen. Der Film «A Single Man» von Elisabeth Weller
17 – sehenswert Beredte Bilder von Claus-Peter Lieckfeld
18 – wundersame zusammenhänge Klang der Ewigkeit von Albert Vinzens
19 – hörenswert «... aus dem Äther in die Existenz» von Ulrich Meier
20 – literatur für junge leser Dolf Verroen «Traumopa» gelesen von Simone Lambert
21 – mit kindern leben Der dunkle November von Bärbel Kempf-Luley und Sanne Dufft
22 – sudoku & preisrätsel
23 – tierisch gut lernen Das Wunder hautnah erleben von Renée Herrnkind und Franziska Viviane Zobel
24 – suchen & finden
25 – ad hoc Kämpfen und zufrieden unzufrieden sein von Jean-Claude Lin
27 – bücher des monats
26 – impressum
3 – editorial
das schaffe ich
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich kann nicht mehr» will es zuweilen in mir ausrufen und bleibt doch im Innern erstickt. Vor lauter Erschöpfung? Oder regt sich noch ein Funken Vernunft, ja Selbsterhaltungstrieb? Es ist allzu oft schwer auszumachen, woher dann doch eine Stimme in mir hörbar wird, die ich mir selbst wie den tiefen Bass aller aufbrausenden, mir zusetzenden Veränderungen des Lebens ruhig und beruhigend zuraune: «Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich.» Daraus wäre vielleicht auch «Eine Art Liebesgedicht» zu dichten, wie es Erich Fried einmal tat. Er, der vor hundert Jahren an einem 6. Mai in Wien geboren wurde, ab 1938 viele Jahre im Londoner Exil lebte und vor 33 Jahren am 22. November 1988 in Baden-Baden starb, wandte sich mit acht Fragen an seine Geliebte:
Wer sehnt sich nach dir
wenn ich mich nach dir sehne?
Wer streichelt dich
wenn meine Hand nach dir sucht?
Bin das ich oder sind das
die Reste meiner Jugend?
Bin das ich oder sind das
die Anfänge meines Alters?
Ist das mein Lebensmut oder
meine Angst vor dem Tod?
Und warum sollte
meine Sehnsucht dir etwas bedeuten?
Und was gibt dir meine Erfahrung
die mich nur traurig gemacht hat?
Und was geben dir meine Gedichte
in denen ich nur sage
wie schwer es geworden ist
zu geben oder zu sein?
Dieses und andere «Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte» von Erich Fried sind in dem erstmalig 1983 und viele Male danach im Verlag Klaus Wagenbach in Berlin veröffentlichten Band Es ist was es ist nachzulesen und darin sind, wie in der Verdichtung des Lebens überhaupt, der Lebensmut und das Wunder des Lebens zu empfinden.
Kommen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gut durch die dunkle Jahreszeit!
Von Herzen grüßt Sie,
Ihr


4 – im gespräch

Handeln aus Liebe zum Leben
Cordula Weimann im Gespräch mit Julia Meyer-Hermann
Fotos: Wolfgang Schmidt
An einem Nachmittag mit ihrem Enkel überfiel es sie plötzlich: das Gefühl, sofort etwas tun zu müssen. Cordula Weimann hatte den Jungen an diesem Sommertag im Jahr 2019 aufs Fahrrad gesetzt, hatte ihm gezeigt, wie man tritt und lenkt. Die 62-Jährige hatte mit ihm Bäume und Blumen angeschaut, Insekten beobachtet und deren Bedeutung erklärt. «Und plötzlich fragte ich mich, welchen Sinn das eigentlich hat …» Warum sollte sie ihren Enkelkindern all das beibringen, wenn die es wohlmöglich gar nicht mehr gebrauchen könnten? «Seit meiner Generation wurden in ganz großem Stil natürliche Ressourcen verschwendet, die Umwelt zerstört, der Klimawandel vorangetrieben.» Wie sollte sie ihren Enkeln später erklären, dass sie sehenden Auges nichts gegen die Zerstörung ihrer Zukunft unternommen hatte? Wenig später gründete die Leipziger Unternehmerin die Umwelt-Initiative «Omas for Future»: Mit Informationen und Aktionen klärt Cordula Weimann seitdem über alltägliche Umweltsünden auf und zeigt Alternativen, und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit ganz viel Humor, Energie und Leidenschaft.

Julia Meyer-Hermann | Frau Weimann, aus einem schlechten Gewissen folgt noch keine Verhaltensänderung. Sie aber haben nicht nur Ihren eigenen Lebensstil mit Ü60 umgekrempelt, sondern 2019 auch noch die Initiative Omas for Future gegründet. Wie kam es zu dieser Idee?
Cordula Weimann | Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon länger das Gefühl, dass es nicht damit getan wäre, wenn nur ich etwas ändere, sondern dass unsere Gesellschaft radikal in puncto Klima- und Umweltschutz umdenken muss. Einer meiner Freunde war Fachbereichsleiter im Umweltbundesamt. Der hatte einen exzellenten Überblick über alle Daten und zeigte mir eines Tages eine Bildschirmanimation, wie die Temperatur der Erde seit 1850 steigt. Zunächst gab es eine langsame Entwicklung, aber in den letzten 20 Jahren kam es zu einem rasanten Temperaturanstieg. Seitdem habe ich daran gezweifelt, ob unsere bisherigen Maßnahmen ausreichen und ob das Abkommen der Pariser Klimakonferenz von 2015 überhaupt eingehalten wird. Als dann 2019 eine Fridays for Future–Demonstration durch Leipzig zog, wusste ich plötzlich, was ich tun musste. Auf einer der nächsten Demonstrationen stand ich mit einem großen Schild mit der Aufschrift: «Hallo Kinder! Schickt mir eure Omas und Opas. Ich brauche Unterstützung».
JMH | Wozu wollen Sie andere Omas und Opas mobilisieren?
CW | Mir geht es nicht um die große Politik und um die Kritik am Gesetzgeber. Diesen Job macht bereits die Jugendbewegung. Ich möchte das Bewusstsein des Einzelnen verändern. Ich möchte aufklären und informieren. Wie schade ich durch meine Alltagsgewohnheiten dem Klima? Und welche kleinen Veränderungen können schon helfen? Die meisten ahnen gar nicht, welchen Schaden sie tagtäglich anrichten. Mir selbst ging es ja etliche Jahre genauso! Seit ich aber weiß, wie viel Wasser ich zum Beispiel durch die Herstellung eines einzigen neuen T-Shirts verunreinige, habe ich keinen Spaß mehr an unnötigem Konsum. Bis zu 15.000 Liter Wasser werden dafür benötigt! In vielen Produktionsländern werden die Chemikalien ungefiltert und ungeklärt direkt in den Boden und ins Grundwasser geleitet. Ich überlege inzwischen ganz genau, was ich wirklich brauche.
JMH | Inzwischen ist Ihre Initiative mit über 40 Regionalgruppen bundesweit vernetzt und stimmt große Aufklärungskampagnen und Aktionen aufeinander ab. Ist Ihr Enthusiasmus sofort auf andere übergesprungen?
CW | Naja, mein Aufruf auf der erwähnten Demonstration damals hat nicht wirklich funktioniert. Bei der ersten großen globalen Demo im September 2019 habe ich dann meine Freundinnen mobilisiert und gesagt: «Ich brauche eure Hilfe. Ihr als meine Freundinnen tragt bitte das große selbstgemalte Banner mit Omas for Future – Aus Liebe zum Leben durch die Demo. Und das haben die brav gemacht. Ich hatte dann das Glück, dass ich kurz darauf auf einem Elternabend der Parents for Future einen Vortrag halten durfte. Nach dem Vortrag sind dann tatsächlich etliche Leute zu mir gekommen und wollten mitmachen. So gründete sich die erste Ortsgruppe. Wir sind übrigens nicht nur Omas, wir haben auch viele Opas im Team!
JMH | Haben Sie viele Mitglieder aus Ihrem Freundeskreis gewonnen?


CW | Ich glaube, dass die meisten unserer Gruppengründer die Erfahrung machen, dass die Wertvorstellungen und auch die Bereitschaft zu Engagement an diesem Punkt öfter auseinanderdriften und Freunde eher selten mit aufspringen. Manche ernten auch Reaktionen wie «Das ist ja völlig übertrieben, was du machst. Was soll das denn? Es geht uns doch gut.» Oder «Wir können doch sowieso nichts ändern.»
JMH | Wie reagieren Sie persönlich darauf?
CW | Es bringt überhaupt nichts, die Spaßbremse zu sein und Vorträge zu halten. Ich erreiche nichts, wenn ich ungeduldig oder belehrend mit erhobenem Zeigefinger bin. Es bringt mehr, vorzuleben, was möglich ist. Und viele meiner Freunde beobachten mit Interesse die Veränderungen in meinem Leben. Ich fliege nicht mehr für Kurzurlaube und fahre viel Bahn. Meinen dicken Sportwagen habe ich abgeschafft und gegen ein kleines, Ressourcen sparend gebautes Elektro-Auto ausgetauscht. Leider kann ich nicht nur aufs Fahrrad umsteigen, dafür lebe ich zu ländlich.
JMH | Fiel es Ihnen denn schwer, Ihren Alltag so umzustellen?

CW | Viele Menschen reden über den Verzicht, den diese Umstellung mit sich bringt. Aber es geht weniger um Verzicht als um Bewusstheit und Wertschätzung. Wir Älteren kennen nachhaltiges Leben noch aus unserer Kindheit. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es zum Beispiel nur einmal in der Woche Fleisch gab. Fleisch war sechsmal so teuer wir heute. Es war etwas Besonderes – und das ist auch gut so! Denn für ein kleines 250-Gramm-Steak vom Rind, blasen wir jede Menge Treibhausgase in die Atmosphäre, verursachen also Müll. Und vor allem holzen wir für den Futtermittelanbau seit Jahren den Regenwald ab. Das setzt sich in anderen Bereichen fort. Früher bekam ich zu Ostern ein oder zwei neue Kleidungsstücke für den ganzen Sommer. Auf die war ich dann so stolz, dass ich sie sofort angezogen habe, obwohl es mitunter noch bitterkalt war. Ich habe sie getragen, bis sie nicht mehr passten oder zu abgetragen waren.
JMH | So denkt und handelt heute aber kaum noch jemand.
CW | Richtig, dieses Denken wurde in den 1990er- und 2000er-Jahren durch einen wahnsinnigen Konsumrausch abgelöst. Auf einmal war es viel billiger, etwas Neues zu kaufen, statt einen Strumpf zu stopfen. Und es lohnte sich auch gar nicht mehr, eine Waschmaschine zu reparieren, weil die neue viel billiger war. Wir haben angefangen, unsere Natur in einem ungesunden Ausmaß zu belasten. Aber wir wurden über die Konsequenzen unseres Verhaltens nicht wirklich informiert, sonst wären wir vielleicht vorsichtiger gewesen.
JMH | Sie sagen «Wir». Sie waren also offensichtlich Teil dieses Konsumrauschs.
CW | Durchaus – ich bin eine Zeit lang mitgerauscht, ich war Teil dieser Höher-weiter-schneller-Generation. Ich war selbstständig, habe hart gearbeitet und war erfolgreich. Ich fand es cool, dass ich mir das alles leisten und mithalten konnte. Ich kann mich gut an den Moment erinnern, in dem ich dachte: «Ich habe jetzt so malocht und meine Lebenszeit geopfert, jetzt will ich mir im Urlaub auch richtig was gönnen». Ich hatte viel Freizeit geopfert für ganz viel «Mist» und für Stress am Schreibtisch, für schlechte Nachrichten und für schwierige Momente. Luxus brauchte ich quasi als Wiedergutmachung. Ich dachte wirklich, das hätte ich mir jetzt verdient. Ich war zwar nie der Typ für eine Kreuzfahrt, aber ich bin mit meiner Familie oft in den All-Inclusive-Urlaub geflogen. Und meine Kinder sind alle im Sportcabriolet groß geworden. Die saßen alle drei auf der Rücksitzbank, total unbequem und unnötig, aber ich fand das angemessen. Obwohl ich auch zu diesem Zeitpunkt jede Woche mein Greenpeace-Heft bekam, habe ich überhaupt nicht hinterfragt, was mein Verhalten eigentlich für unsere Erde bedeutet. Im Nachhinein befremdet mich das zwar, aber dadurch kann ich die Muster und Alltagsroutinen, in denen viele stecken, natürlich gut nachvollziehen. Und ich weiß auch, dass dieser Konsumrausch uns überhaupt nicht glücklich macht. Wie auch, wenn die Wertschätzung fehlt.

JMH | Wie wollen Sie diese Wertschätzung wecken?
CW | Wir klären über Zusammenhänge auf und versuchen, die Menschen im Herzen abzuholen. Die meisten lieben die Natur. Viele Dinge, die wir sehr genießen, hängen davon ab, dass wir unsere Natur erhalten. Wir motivieren die Menschen, sich ihrer «grünen Wünsche» bewusst zu werden und ihre Anliegen schriftlich zu fixieren. Bei einer großen Demo im November 2019 haben wir zum Beispiel Wunschzettel verteilt, auf denen man festhalten konnte, was man sich dazu von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, der Stadt, der Politik erhofft. Diese 1000 Wunschzettel haben wir zusammen mit Parents for Future dann in Leipzig in der Fußgängerzone am «Black Friday» auf den Boden geklebt: in Form eines großen Tannenbaums. Das haben sich unglaublich viele Passanten angesehen und uns mit Fragen gelöchert. Inzwischen können wir auch auf unsere Website verweisen, wo es viele Infos zu alltäglichen Fragen und einen Link zu unserem Podcast «Zukunft Jetzt» gibt. Und wir versenden kostenlos unser kleines Quizbuch: Das 1 x 1 der Zukunft – Teste dein Wissen.
JMH | Wie haben Sie all das finanziert? Haben Sie Fördergelder bekommen?
CW | Für diese Art Finanzierung sind wir viel zu schnell. Wenn Sie Fördergeld beantragen, müssen Sie ein halbes Jahr warten, bis das genehmigt ist, und vorher dürfen Sie nichts tun. Wir sind aber innerhalb kürzester Zeit ganz enorm gewachsen und haben umgehend ganz viel initiiert und organisiert. Das ging nur, indem ich anfangs viel von meinem Geld in die Hand genommen und gesagt habe «So, ich bezahle die Homepage. Ich bezahle die Druck- kosten der Werbemittel. Ich bezahle auch die Bürokraft». Inzwischen werden etwa 20 Prozent unserer Kosten durch Spenden finanziert. Den Rest bezahle ich aus eigener Tasche. Und ja, ich hätte mir auch einen SUV kaufen können, von dem Geld, das ich investiert habe. Aber all mein Privatbesitz und mein Geld nützen mir nichts mehr, wenn wir unsere Welt nicht retten. Und der Folgegeneration nutzt es noch viel weniger, weil schließlich ihre Zukunft auf dem Spiel steht.
JMH | In diesem Sommer haben Sie das Projekt «Klimabänder» gestartet. Worum ging es da?
CW | Wir wollten das Klimathema sichtbar in den Alltag bringen. Hierbei waren die Klimabänder die Klimabotschafter. Mit Unterstützung der Parents, der Students und der Churches for Future – die Bewegung ist in alle Richtungen gewachsen – haben tausende Menschen dabei in verschiedenen Städten Deutschlands ihre Klimawünsche und -forderungen auf bunte Stoffbänder geschrieben. Wir haben sie zunächst wochenlang sichtbar im Wind wehen lassen, zum Beispiel am eigenen Fahrrad, im Vorgarten, in der Schule, an der Kirche. Dann haben wir die Bänder gesammelt und sie mit dem Fahrrad – also klimaneutral – nach Berlin gebracht. So kann die neue Regierung deutlich sehen, welche Forderungen wir haben.
JMH | Was stand auf Ihrem Klimaband?
CW | Da stand «Bio um jeden Preis. Ohne Insekten können wir nicht leben». Das Artensterben ist für uns genauso bedrohlich wie die Klimaerwärmung.
JMH | Und was sagen Sie denen, die Bio zu teuer finden?
CW | Am Ende ist das immer eine Frage der Gewichtung. Was gebe ich für Bio-Milch aus und was für eine Kugel Eis? Und wie teuer kommt es uns zu stehen, wenn wir so weitermachen? Viele Menschen machen sich nicht klar, wer der weltweit größte Produzent ist. Das ist nicht Nestlé, VW oder Amazon. Nein! Die Natur selbst schenkt uns Jahr für Jahr Rohstoffe und Ressourcen im Wert von 113 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Alle Volkswirtschaften dieser Erde erwirtschaften gemeinsam 72 Billionen US-Dollar. Ohne das, was die Erde uns schenkt, können wir nicht leben. Warum aber achten wir dann nicht auf sie? Die Natur schreibt eben keine Rechnung – und das genau ist ihr Verhängnis. Denn hätte sie eine Rechnung geschrieben, hätte sich der Raubbau nicht gerechnet.

5 – thema
Unterwegs zwischen Extremen
Fjodor Michailowitsch Dostojewskij, geboren am 11. November 1821
von Evelies Schmidt

Das Allerhauptsächlichste und Allerteuerste ist unsere Persönlichkeit und unsere Individualität», verkündet der Ich-Erzähler des Romans Aufzeichnungen aus dem Kellerloch (1865). Ihn umstandslos mit dessen Autor, Fjodor Dostojewskij, gleichzusetzen verbietet sich. Dennoch – Individualität, und zwar ausgelotet in all ihren dramatischen Facetten, ist ein unüberhörbares Grundthema bei Dostojewskij – als eigene Erfahrung wie in der Gestaltung seiner literarischen Figuren.
Auch sonst scheint man in diesem kleinen Roman dem Schriftsteller bei einer Fingerübung über die Schulter zu sehen, einem Vorspiel zu seinen späteren großen Romanen: Verbrechen und Strafe (Schuld und Sühne), Der Idiot, Böse Geister (Die Dämonen), Ein grüner Junge (Der Jüngling) und Die Brüder Karamasow. Gegen Vernunftherrschaft und Naturgesetz wird die Persönlichkeit von dem namenlosen Kellerloch-Bewohner verteidigt. Dabei gibt er sich in ironischem Ton als durchaus gespaltene Persönlichkeit zu erkennen, stellt seine Aussagen umgehend durch ihnen widersprechende infrage. Es ist ihm bewusst gewesen, «dass in seiner Seele viele widerstreitende Elemente sind».
Ja, ohne innere und äußere Dramatik, Zwiespalt, Ambivalenz, Spannung und Mehrstimmigkeit ist Dostojewskij als großartiger Erzähler nicht «zu haben» (und war er wohl auch als Person nicht). Und darin ist er modern.
Hier noch einmal der Kellerloch-Mensch, diese «Maus mit verschärftem Bewusstsein»: «Was mich im Besonderen angeht, so habe ich in meinem Leben lediglich bis zum Äußersten geführt, was Sie nicht einmal zur Hälfte gewagt haben …» Dostojewskij bezeugt in einem Brief (vom 28.8.1867), von Natur aus stets und in allem bis zum Äußersten zu gehen, ein Leben lang die Grenze überschritten zu haben. Was tat sich dahinter auf? Von der Spielleidenschaft ließ er sich restlos hinreißen. Kam erst nach Jahren von seiner Sucht wieder los. Eine literarische Frucht war der 1866 erschienene Roman Der Spieler, knapp 200 Seiten, geschrieben in dreieinhalb Wochen. Und das parallel zur Arbeit an dem weit anspruchsvolleren Roman Verbrechen und Strafe. Dostojewskij brauchte dringend Geld. Dass ihm in der Zeitnot eine junge Stenotypistin namens Anna zu Hilfe kam, die bald seine Frau wurde, gehört zu den ausgesprochen glücklichen «Zufällen». Er setzte sich selbst aufs Spiel und war im Rausch des Risikos fähig, ungeheure schöpferische Ressourcen freizusetzen. In diesem Fall, wie noch später viele Male.
Zwei Arten extremer Erfahrung allerdings entzogen sich seinem freien Bestimmen: die schweren epileptischen Anfälle – vielfach erlitten, und, einmalig einschneidend, mit langen Folgen – ein Moment der Schwebe zwischen Leben und Tod, herbeigeführt vom Zaren: Der durchschlagende Erfolg seines Romandebüts Arme Leute (1846) lag noch nicht lange zurück, als sich der Schriftsteller dem sozialutopisch gesinnten Kreis um Michail Petraschewskij anschloss, der die Ideen von Charles Fourier in Russland umsetzen wollte, was dem Zaren Nikolaus I. brandgefährlich erschien. Am 23. April 1849 lässt er einige Petraschewzen verhaften, unter ihnen Fjodor Dostojewskij. Nach Monaten der Gefangenschaft in der Peter-Pauls-Festung wird das Todesurteil über sie gesprochen. Am 22. Dezember führt man sie zur Erschießung, um ihnen im allerletzten Moment den – schon länger gefassten – Beschluss des Zaren zu verkünden: Verbannung nach Sibirien, Katorga statt Tod. Die unerwartete Begnadigung hat Dostojewskij als seine «Auferstehung» angesehen («Das Leben ist Glück, jede Minute kann eine Ewigkeit Glück bedeuten … Jetzt, da mein Leben sich ändert, werde ich neu geboren», schreibt er am Abend jenes Tages an seinen Bruder Michail).
Tasuta katkend on lõppenud.