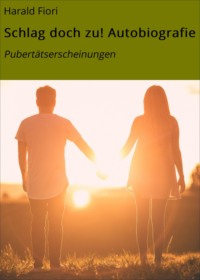Loe raamatut: «Schlag doch zu! Autobiografie»
Harald Fiori
Schlag doch zu! Autobiografie
Pubertätserscheinungen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Schlag doch zu!
Prolog
Lehrer werden geboren
Geschichtliches und Wichtiges
Schöner Lehreralltag
Die Wurzeln eines Lehrers
Katholisches Oberlyzeum zu Dortmund.
Neu an der Schule
Das zweite Lebensjahr im Jahre 1942
Erste eigene Erinnerungen
In Bad Godesberg
Arme Schülergeneration
Besatzungszeit in Godesberg
Kinder im Schullandheim
Kindheit im Wirtschaftswunderland
1949
1950
1951
1952
1953
„Ein schöner Garten“
1954 / 1955
Endlich Lehrer mit Anstellung
Lehrerprüfung
Impressum neobooks
Schlag doch zu!
Pubertätserscheinungen
Harald W. Fiori
Roman
Prolog
Als Lehrer, besonders als Idealist unter den Lehrern, habe ich das unbestimmte, sehr stark drängende Gefühl, mich innerlich und äußerlich pausenlos und ständig für meinen Beruf und meine Tätigkeiten entschuldigen zu müssen.
Kaum treffe ich nachmittags jemanden aus der Nachbarschaft, höre ich schon die besorgte, hämische bis sensationslüsterne Frage: „Wie geht’s denn Herr Fiori? Alles in Ordnung? Ist ja nicht einfach in Ihrem Beruf. Haben Sie schon frei? Ach ja, es ist ja schon Nachmittag. Da sind Sie bestimmt froh, dass Sie sich jetzt entspannen können. Mein Mann kommt heute Abend wieder später nach Hause, muss ständig Überstunden machen.“
Und da ist es dann, das lächerliche Minderwertigkeitsgefühl, das absolut schlechte Gewissen, der Wunsch zu erklären, dass ich keineswegs frei habe nun, dass ich eigentlich nur deshalb so unverschämt bin, schon nachmittags einkaufen zu gehen, weil ich blöderweise ausgerechnet heute Nachmittag neue Tinte brauche.
Natürlich brauche ich nicht immer neue Tinte. Dann käme die Entschuldigung leichter und flüssiger über die Lippen. Es kann nämlich sein, dass ich wirklich Lebensmittel einkaufe, weil meine Frau, aus welchen Gründen auch immer, gerade dazu nicht gekommen ist. Ja, es ist sogar möglich, dass ich darum gebeten habe, einkaufen zu gehen, weil ich einfach mal etwas anderes tun möchte, als meinem Beruf nachzugehen. Leider kann ich eine Antwort nicht runterschlucken, und schon ist sie da, die Entschuldigung, die Rechtfertigung:
„Leider habe ich auch noch keinen Feierabend, zweiunddreißig Aufsätze liegen zu Hause und warten auf Korrektur.“ Si tacuisses, Philosophus mansisses, ‚Wenn du doch geschwiegen hättest, wärest du ein kluger Mann geblieben’. Hätte ich doch nur geschwiegen.
„Ach ja, meine Tochter wartet oft mehrere Monate lang darauf, dass eine Arbeit benotet und zurückgegeben wird. Der Lehrer hat immer andere Gründe, warum er mit der Korrektur noch nicht fertig geworden ist. Aber nun muss ich weiter, soviel Zeit habe ich nicht, auch wenn ich nur Hausfrau bin.“
War das schon wieder eine Spitze?
Noch schlimmer ist es aber, als Lehrer vormittags schon beim Einkauf erwischt zu werden, weil der Stundenplan einmal in der Woche ausnahmsweise erst um 11.00 Uhr beginnt. Dann begegne ich mit absoluter Sicherheit nicht nur einer Nachbarin, meistens treffe ich alle, die ich kenne, als hätten sie sich verabredet. Und dann wird’s so richtig nett.
Die Stimmen der Damen triefen geradezu vor Freundlichkeit: „Sind Sie krank, Herr Fiori? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Wie geht’s Ihrer Frau? Haben Sie schon frei?“
Das „Kümmern Sie sich doch um Ihren eigenen Scheiß!“ schluckte ich tapfer hinunter, um zum wievielten Male heraus zu trompeten, dass ich ausnahmsweise an diesem Morgen erst um 11.00 Uhr zur Schule muss. Und wieder der Drang zur Rechtfertigung: „Dafür habe ich aber auch heute Nachmittag noch Unterricht bis 16.00 Uhr“. Warum nur ist mir das nun wieder rausgerutscht? Hätte ich doch nur geschwiegen, fühlte ich mich weniger vorgeführt.
Die Antworten gleichen sich irgendwie alle: „Mein Mann kommt immer erst um 19.00 Uhr, er geht auch jeden Morgen um 7.30 Uhr aus dem Haus.“ Ich sollte mich wirklich schämen, ich Nichtstuer!
Schließlich ist doch jedem bekannt, dass Lehrer geboren werden, zur Schule gehen und eine gute Pension oder Rente erhalten, unmittelbar nach dem Schulbesuch, versteht sich.
Etwas weniger bekannt ist die Rechnung, dass Lehrer so gut wie gar nicht arbeiten, also nur frei haben im Laufe eines Jahres:„ Ein Jahr hat bekanntlich 365 Tage, alle vier Jahre 366. Mit 366 lässt sich besser rechnen. Denn Lehrer arbeiten, das ist wirklich jedem geläufig, nur halbe Tage, also arbeiten sie im Jahr nur 183 Tage. Im Durchschnitt eines jeden Jahres haben Lehrer 53 Tage Ferien, so dass noch 130 Arbeitstage bleiben, aber es gibt natürlich noch 52 Wochenenden, an denen keine Schule ist, so dass noch einmal 104 Tage abgezogen werden müssen, bleiben 26 Arbeitstage, von denen selbstverständlich noch die Feiertage abgezogen werden müssen, das sind pro Jahr durchschnittlich 10, es bleiben ganze 16 Arbeitstage, von denen der Tag für den Kollegiumsausflug abzuziehen wäre, und schließlich feiert jede Lehrperson im Durchschnitt etwa 15 Tage krank im Jahr. Eigentlich hat man es immer schon gewusst: Lehrer arbeiten absolut nicht einen einzigen Tag im Jahr, was zu beweisen war.“
Bei soviel Bestätigung für die offensichtlich angeborene Faulheit von Lehrern sollte man nun annehmen, dass Lehrer wenigstens untereinander sich sehr kollegial verhalten und natürlich wissen, wie fleißig sie in Wirklichkeit sind. Wieder weit gefehlt. Der einzige wirklich fleißige Lehrer bin nur immer ich ganz allein. Und das behauptet schlichtweg jede Lehrerin und jeder Lehrer von sich. Die Kolleginnen und Kollegen, na ja, sprechen wir lieber nicht darüber. Man schaue sich nur den Stundenplan genau an: „Herr Fiori, aus welchem Grunde haben Sie eigentlich nur drei Springstunden in Ihrem Plan? Müssten Sie nicht wegen Ihrer Sonderstunde als Beratungslehrer noch eine Stunde mehr im Schulgebäude sein? Sie haben doch für diese Tätigkeit schon zwei Stunden weniger zu unterrichten!?!“ Und wieder, selbst hier im vertrauten Kollegenkreis überkommt mich das gewohnte, nicht mehr aus meinem Leben wegzudenkende Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Oder sollte ich lieber antworten: „Ach, liebe Kollegin, Sie können ja gerne die Ausbildung zum Beratungslehrer absolvieren und mich danach ablösen!“ Was sage ich aber tatsächlich: „Ach, wissen Sie, Frau Kollegin, im Augenblick habe ich soviel mit Beratung zu tun, dass ich schon weit mehr Stunden damit verbringe als ich an Ermäßigung erhalte. Allein die Schülerin ..... .“ Lerne ich es denn nie? Schweigen ist Gold!„Ja, ja, damit haben wir doch alle unser Kratzen, oder meinen Sie, ich würde meine Schülerinnen und Schüler nicht beraten!?!“ Das hat wieder mal gesessen. Soll ich etwas erklären, mich rechtfertigen? Ich glaube ich resigniere einfach und erzähle, wie ein fauler Lehrer auf die Welt kommt und eben ein wirklich fauler Lehrer wird. Beinahe hätte ich die Hauptpersonen vergessen im Leben eines Lehrers, oder die, die Hauptpersonen sein sollten, wenigsten meiner Meinung nach: „Die lieben oder nicht immer lieben Schülerinnen und Schüler.“ Solange ich als Lehrer tätig war, war ich bei den Schülerinnen und Schülern immer sehr beliebt, was bedeutet, dass ich eigentlich mit meiner Berufstätigkeit sehr zufrieden sein könnte, da ich meiner Meinung nach diese Beliebtheit erworben habe durch besonderen Fleiß ( wie bereits oben angemerkt!) und besonderen Einsatz für die Belange der Schülerinnen und Schüler. Außer der Tatsache, dass diese Aussage sehr nach Eigenlob stinkt, klingt sie gleichzeitig auch ein wenig nach Rechtfertigung und nach Entschuldigung, diesem ständigen Begleitphänomen in meinem Leben. Denn auch bei den Kindern, die ich zu betreuen hatte, kam es immer wieder vor, dass ich mich entschuldigen musste: dafür, dass die Arbeit noch nicht benotet war, dafür, dass einige andere Lehrer zu streng waren in den Augen der Kinder, dafür, dass es trotz großer Hitze keine Stunde Hitzefrei gab, dafür, dass ich wegen eines dringenden Gespräches mit einer Mutter oder mit einem Vater drei Minuten zu spät in den Unterricht kam, dafür, dass ich nun wirklich die lange angekündigte Klassenarbeit schreiben ließ, obwohl doch die armen Kinder aus mancherlei Gründen gerade in dieser Unterrichtsstunde eigentlich gar nicht dazu in der Lage waren, dafür, dass ich überhaupt da war und nicht wegen meiner Erkältung oder wegen meiner unerträglichen Rückenschmerzen oder wegen des hohen Fiebers zu Hause geblieben war, wie die Kinder gehofft hatten, dafür, dass ich eine schlechte Arbeit tatsächlich schlecht benoten musste, und so ließe sich diese Liste endlos fortsetzen. Entschuldigt bitte, dass ich geboren bin!!!
Lehrer werden geboren
Geburtstag, 02. Februar 1941: Ein Kriegskind
Zur Zeit meiner Geburt wohnten meine Eltern mit meiner Schwester Ursula, die schon sechs Jahre alt war, in Essen, im Ortsteil Margarethenhöhe , Im Stillen Winkel 40.
Diese Wohnung in der ersten Etage auf der rechten Seite des Hauses hatten meine Eltern bekommen, nachdem meine Mutter herzzerreißend beim Verwaltungsdirektor darum gebettelt hatte, wie sie mir oft erzählte, weil sie so sehr verliebt war darin, kaum dass mit dem Neubau begonnen worden war..
Hinter dem Haus gab es einen Garten, der in insgesamt vier Abschnitte aufgeteilt war, für jeden Mieter einen. Der Gartenabschnitt, der zur Wohnung meiner Eltern gehörte, grünte und blühte seitlich neben dem Haus, freundlich strahlte ein weißer Lattenzaun anmutig zur Straße hin, der den Garten von der Straße abtrennte. Heute erinnert daran nur noch ein Bild, das meine Schwester und mich beim Spiel vor diesem Zaun zeigt. Denn nach dem Krieg wurde das Haus leicht umgebaut und statt des Gartens eine Garagenanlage hinter dem Haus eingerichtet, um der vielen Autos des Nachkriegswunders Herr zu werden.
Über zwei Treppenabsätze gelangte man zur Wohnungstür in der ersten Etage. Von dort ging es zunächst in einen Korridor oder Flur, von dem aus sich die Zimmertüren der einzelnen Räume links und rechts erstreckten.
Mittelpunkt der Wohnung war das Wohnzimmer. Dort thronte als Blickfang an der Wand ein majestätisch aussehendes, sogenanntes Büffet, ein Wohnzimmerschrank aus glänzendem rotbraunem Nussbaumholz. Es schaute freundlich von der langen Zimmerwand herab und erinnerte mich immer an eine Mutter, die lieb und sorgend in das Zimmer blickt.
Dieses Büffet war der Stolz der Familie. Es bestand aus insgesamt drei Teilen. Der etwa 2,20 m breite und 1.20 m tiefe Unterschrank stand auf runden Füßen und war mit einer etwa zehn Zentimeter breiten massiven Leiste unten an den Seiten und der Vorderfront eingefasst. Beide Türen waren reich verziert mit plastischen Blumen und Rankenornamenten, abgedeckt war dieser Unterschrank mit einer massiven Platte, die über den Schrankkorpus genau so weit herausragte, wie die Unterleiste. Als besonders moderner Clou befand sich zwischen zwei Schubladen und der Abdeckplatte eine herausziehbare drei Zentimeter starke Arbeitsplatte, mit zwei runden Knöpfen links und rechts zum Herausziehen.
Über diesem Unterschrank, der etwa einen Meter hoch war, erhob sich ein, auf zwei runden, gedrechselten etwa dreißig Zentimeter hohen Zierpfosten stehendes Oberteil, das hinten von einem Abschlussbrett gehalten wurde. Dieses Oberteil war insgesamt genau so hoch wie der Unterschrank und bestand aus einem mittleren schmalen Schrankteil mit zwei ebenso reich verzierten Türen, wie sie auch der Unterschrank aufwies.. Zu beiden Seiten dieses Mittelschrankteils befanden sich zwei kleine Schrankfächer, die etwa vierzig Zentimeter hoch waren und dreißig Zentimeter tief, wie auch der Mittelschrank, und dreißig Zentimeter breit.
Die beiden Seitenteile schauten wie seitlich stehende Augen mit ihren grünen Gläsern in das Zimmer. Verschlossen wurden sie mit Türen mit einer grünen Bleiverglasung. Auf diesem prunkvollen, gediegenen Möbelstück ruhten auf der Unterschrankplatte echte Kristallschalen und Kristallvasen, ebenfalls reich mit eingeschliffenen Ornamenten verziert.
Vom ersten Tag meines Lebens an, besser von dem Tage an, als ich lernte, meine Umgebung bewusst wahrzunehmen, war ich in dieses Büffet verliebt. Es war für mich der Inbegriff des gemütlichen Familienlebens, das ich auf jeden Fall einmal erben wollte, wenn es denn so weit wäre.
Dass sich im oberen Teil des Schrankes das so genannte gute Geschirr verbarg, sei auch erwähnt. Es bestand aus hauchdünnem Porzellan, mit rotbraunen Zeichnungen, die an Beeren oder Kleeblüten erinnerten. Angeblich sollte aus diesem Kaffee-Geschirr der Kaiser selbst getrunken haben. Das war bei einer gutbürgerlichen Familie wohl auch nicht anders zu erwarten.
Zu zwölf Tassen, Desserttellern und Untertassen gehörten eine Kaffeekanne, eine Teekanne, ein Milchkännchen und eine Zuckerdose mit Deckel.
Im Unterschrank befand sich das gute Ess-Geschirr, mit Goldrand verziert, bestehend aus zwölf Suppentellern, zwölf flachen Tellern, zwei Schüsseln, einer Sauciere und vier Vorlege-Tellern. Natürlich war der Goldrand echt, wie es sich für eine Familie unseres Standes gehörte.
Zum Büffet gehörte in gleichem Holz eingefasst ein etwa mannshoher Spiegel, der immer in der Diele bzw. im Flur von der Wand herab dem Eintretenden sein eigenes Bild in voller Größe zeigte.
Passend zu diesem Büffet gab es ein so genanntes Nähschränkchen, das nicht nur aus dem gleichen Holz bestand, sondern auch ebenso reich verziert war. Es war etwa siebzig Zentimeter breit und lang und besaß einen schweren Deckel, den man nach hinten aufklappen konnte. Drinnen bot es, mit rotem Samt und roten Satin ausgeschlagen, Platz für diverses Nähzeug, das eine tüchtige Hausfrau wohl damals häufig in Mußestunden im Wohnzimmer benutzen sollte.
Schwer und gediegen stellten sich auch die Polstermöbel im Wohnzimmer dar, ein Sofa mit Platz für vier Personen, zwei kleine Sessel und ein ganz hoher Sessel, dessen Besonderheit darin bestand, zwei nach innen gestellte Ohren am oberen Ende der Lehne zu besitzen, weshalb er von der Familie immer nur ehrfürchtig „der Ohrensessel“ genannt wurde. Dieser Sessel war der Lieblingsplatz meiner Mutter, die sich darin räkeln konnte, wie sie mochte. Allerdings sah ich sie nie nähend darin sitzen, weshalb auch das Nähtischchen im Wohnzimmer eigentlich an Bedeutung verlor. Meine Mutter konnte nicht nähen, sagte sie jedenfalls immer. Außerdem sei ihr diese Arbeit verhasst.
Alle Polstermöbel waren mit rotbraunem Plüsch bezogen, reich gemustert, ähnlich wie die dunklen Holzmöbel. Vor dem Ohrensessel stand immer eine gepolsterte mit dem gleichen Plüsch bezogene Fußbank, so dass man im Sessel sitzend auch noch seine Bein ausstrecken und hoch legen konnte.
Besonders zu erwähnen ist noch ein Blumen- oder Abstelltisch, etwa 1,30 Meter hoch, kreisrund mit einem Durchmesser von etwa dreißig Zentimetern. Das besondere an diesem Tisch war einmal das Wurzelholz, aus dem der Tisch bestand und zweitens die Intarsien, ein Blumen-, Orchideen-Ornament, in dem Tischrund. Alle Möbel zeugten von gutbürgerlichem Wohlstand oder gar Reichtum.
Ähnlich gediegen wie das Wohnzimmer war auch das Schlafzimmer, furniert mit echter rustikaler Eiche, ebenfalls einem Inbegriff des Wohlstands in diesen Jahren. Es bestand aus einem dreitürigen hohen Kleiderschrank, dessen mittlere Tür einen Spiegel enthielt, was für die damalige Zeit etwas Besonderes war. Neben den beiden schweren, zwei Meter langen Ehebetten standen rechts und links Nachtschränkchen, die eine Tür und eine Schublade enthielten. Hinter der Tür des einen Schränkchen verbarg sich ein Nachttopf. An einer freien Wand glänzte eine Frisierkommode mit drei Schubladen und einem ovalen Spiegel. Auf der Kommodenfläche sah man eine mit goldenen Pflanzen bemalte Wasserkanne in einer Porzellanschüssel stehen, offensichtlich als Waschplatz bestimmt in Zimmern ohne fließendes Wasser.
Die relativ kleine Küche beherbergte einen zweiteiligen Küchenschrank aus echtem Kiefernholz, dazu passend bedeckte die gegenüberliegende Wand ein einteiliger Schrank, auch Sideboard genannt, in denen sich alle sonstigen Töpfe, Pfannen und Geschirr, Bestecke und Küchenutensilien befanden, die in kleinem Haushalt fehlen dürfen. In der Mitte der Küche stand ein Tisch, ebenfalls aus Kiefernholz, jedoch in der Tischplatte ausgelegt mit einem robusten grün melierten Kunststoffbelag für diverse Arbeiten mit Messern oder anderen scharfen Gegenständen, natürlich leicht zu reinigen. Zwei dazu passende Küchenstühle luden zum Sitzen ein, obwohl es in unserer gutbürgerlichen Familie streng verpönt war, in der Küche zu essen oder sich auch nur niederzulassen, um zu plaudern. Dafür war ausschließlich das Wohnzimmer vorgesehen in Ermangelung eines gesonderten Speisezimmers, was eigentlich standesgemäß hätte vorhanden sein müssen. Außer Mutti werkelte nur das Pflichtjahrmädel in der Küche, das auch häufig für die Versorgung und Betreuung des kleinen Erdenbürgers und seiner Schwester eingespannt wurde.
Alle diese besonders feinen Möbel waren beschafft worden aus der Mitgift meiner Mutter, die sehr reichlich ausgefallen sein musste. Vati selbst konnte als Sohn eines gehobenen Beamten keineswegs solche Reichtümer der jungen Ehe beisteuern.
Dass er von der gutbürgerlichen Dynastie der Familie meiner Mutter überhaupt als Schwiegersohn akzeptiert worden war, hatte er nur der Tatsache zu verdanken, dass sein Vater als ein gehobener Postbeamter, ganz offensichtlich auch als dem gleichen Stande zugehörig anerkannt wurde. Er selber hatte allerdings ebenfalls einen recht guten und vor allen Dingen sehr höflichen und bescheidenen Eindruck gemacht und hatte eben mit seiner Schulbildung den strengen Auswahlkriterien der Familie standgehalten.
Etwas weniger feudal ausgestattet war unser Kinderzimmer, das außer einem Bett für meine Schwester auch das Paidi-Kinderbettchen für mich beherbergte neben einem kleinen Kleiderschrank und zwei kleinen Kommoden.
Dass es ein Paidi-Bett war, erwähnte meine Mutter immer wieder, weil diese Marke damals wohl als besonders wertvoll und auch teuer und solide galt.
Im Kinderzimmer konnten wir außerdem ein Kinderstühlchen benutzen, mit am Boden entlanglaufenden Leisten mit einem Tischteil verbunden. Die Lehnen des Stuhles waren rund gebogen, die Tischplatte etwa sechzig Zentimeter im Quadrat. Das ganze Möbelstück war extrem niedrig, eben nur für kleine Kinder bis etwa sechs Jahren geeignet.
Zur Wohnung gehörte dann noch eine Mansarde, die als Gästezimmer eingerichtet worden war.
Sie spielte nur deshalb eine Rolle in den Erzählungen meiner Mutter, weil dort Opa Fiori residierte, wenn er uns besuchte.
Opa Fiori war etwas ganz Besonderes, schon deshalb, weil er entgegen dem damaligen Trend tatsächlich den Kinderwagen seines Enkelkindes Harald schob, was zu der Zeit wohl sonst kein Mann tat, weil es als unmännlich galt.
Am Tage vor meiner Geburt, Samstag, dem 01. Februar 1941, hatte mein Vater Wochenend-Urlaub bekommen, der später als richtiger Urlaub verlängert wurde, so dass er meine Schwester beaufsichtigen konnte während des Krankenhausaufenthaltes meiner Mutter.
Vati, wie er von meiner Schwester und später auch von mir genannt wurde, war als Soldat in Holland stationiert und dort wohl in irgend einer Schreibstube tätig. Laut Aussagen meiner Mutter war er Offizier, laut seinen eigenen Aussagen Fähnrich.
Auf den wenigen vorhandenen Fotografien aus jener Zeit ist zu erkennen, dass er auf den Schulterstücken den Dienstrang eines Unteroffiziers trug. Nicht zu erkennen ist auf dem Ärmel der Uniform, ob ein Sternchen darauf hindeutet, dass er tatsächlich Offiziersanwärter war wegen seiner Schulbildung, der so genannten Primareife , von der er später häufiger sprach. Aber selbstverständlich hätte es nicht zur guten Bürgerlichkeit gepasst, wenn mein Vater tatsächlich „nur“ Unteroffizier gewesen wäre.
Das weltbewegende Ereignis meiner Geburt hatte so sehr wenig Weltbewegendes, dass es überhaupt nicht erwähnt wird in Geschichtsbüchern oder sonstiger Literatur.
Man stelle sich vor, ein so wichtiger Mensch wie ein Lehrer wird geboren, und niemand weiß das. Selbst ich hatte keine Ahnung davon. Nicht nur davon, dass ich Lehrer werden würde, nicht einmal von meiner Geburt. Eigentlich ist das ein schier unglaubliches Phänomen, dass ein Mensch vom eigentlich wichtigsten Ereignis in seinem Leben aus eigener Erinnerung nichts weiß. Alles lernt er später kennen aus Erzählungen anderer, was mit der Geburt und den ersten Lebenstagen im Zusammenhang steht. Hätte ich Erinnerungen an meine Geburt, könnte ich wohl Folgendes erzählen:
„Wohlgeborgen schwimme ich hier in warmer Flüssigkeit, von Liebe umgeben. Doch was ist das!?! Was stößt hier so entsetzlich? Warum wird mein Kopf nach unten gedrückt? Hilfe, Hilfe, nun verschwindet auch noch das wohltuende Bad um mich herum! Gott sei Dank ist es noch warm, aber viel trockener. Hört doch auf zu drücken! Das ist ja fürchterlich aufregend! Ah, nun werde ich ruhiger! Aber nein, ihr wollt mich doch nicht dort Kaputtdrücken! Was soll das? Hier ist kein Platz für meinen Kopf! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mein Kopf wird zerquetscht. Aus, nein wie kalt! Ich falle, nein ich stürze! Nichts hält mich auf, warum werde ich nicht gehalten? Ich stürze, ich stürze! Hilfe! Doch nun hält mich was, es tut weh. Was ist das für ein Geräusch oder was merke ich da? Ah, nun werde ich gehalten, etwas Wärme umgibt mich. Endlich! Wo bin ich? Was bin ich?“Mutti hat an den Geburtsvorgang leicht andere Erinnerungen. Der erste oder zweite Februar 1941 war weder weltgeschichtlich noch heimatgeschichtlich von irgendwelcher besonderen Bedeutung. Sicher, man weiß, dass dieses Jahr ein Kriegsjahr war, noch das zweite Kriegsjahr, um genau zu sein. Man weiß vielleicht auch, dass zu diesem Zeitpunkt die deutsche glorreiche Armee auf dem Vormarsch war, zumindest verkündeten die deutschen Medien, hauptsächlich der Volksempfänger, mit dem alle Familien ausgestattet waren, auch gutbürgerliche, genau immer wieder dieses. „Die deutschen Truppen erringen Siege an allen Fronten.“ Dabei wurden auch lobend die Vormärsche der Verbündeten, der Italiener und der Japaner, erwähnt, die Gebiete eroberten, von denen man in Deutschland nur Kenntnisse hatte, wenn man ein gebildeter Mensch war und gut im Geographieunterricht aufgepasst hatte. Aber alles Übrige war schon etwas wenig erwähnenswert. Man merkte auch in Deutschland nicht so sehr viel davon, dass Krieg war, obwohl man sich schon wundern musste, dass es nicht immer alles zu kaufen gab, was man früher in Friedenszeiten bekommen konnte. Es ist ein eigentümliches Phänomen des Krieges, dass die Sieger im eigenen Land niemals hören, welches Leid angerichtet wird, sondern nur, welche Erfolge errungen werden. Wenn es Tote zu beklagen gibt, sind die Gefallenen des Siegerlandes allemal Helden, während Gefallene des Verlierervolkes arme irregeleitete Schweine sind, denen man eigentlich den Tod nicht gegönnt hat. Manchmal sind feindliche Soldaten auch Bestien in Menschengestalt. Was also gab es noch am ersten Februar 1941? Das Radio verkündete laut und eindringlich: „Bei den Ski-Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d’Ampezzo ist deutsche Mannschaft die erfolgreichste der Welt. Immer noch erfolgreich ist der Vormarsch der glorreichen deutschen Armee, ob in Italien, in der Sahara oder im Süden Argentiniens unserem Flugstützpunkt auf Feuerland! Sieg Heil den deutschen Truppenverbänden!“ Dass sportliche Weltmeisterschaften ausgefochten wurden in diesen Kriegstagen, die nun schon fast zwei Jahre dauerten, wunderte mich immer wieder. Offenbar lebte man in Deutschland wirklich unbehelligt vom Krieg, nur die jungen Väter waren eben nicht zu Hause.Der Krieg fand woanders statt! Die Not und das Elend, das deutsche und italienische Truppen in das übrige Europa brachten, sogar nach Nordafrika und in den Vorderen Orient, betraf nicht die Menschen in der deutschen Heimat, die davon auch nichts hörten, sondern nur von den phantastischen Erfolgen der Verbündeten in einem Krieg, der nach Darstellung der Machthaber dem deutschen Volk aufgezwungen worden war. Natürlich wurde auch meine Geburt in der Zeitung erwähnt, nämlich wie vor allem bei gutbürgerlichen Familien üblich in der Zeitung unter Geburtsanzeigen. Dort stand zu lesen: Harald = Walter
Ursel hat ein strammes Brüderchen bekommen.Dieses zeigen hocherfreut anWalter Fiori und Frau Margarete geb. Leggewie Essen, den 2. Februar 1941 Im Stillen Winkel 40 z. Zt. Huyssensstift
Mein Vater war nicht in der Partei, wie er immer wieder betonte, später. Er war in Holland stationiert während der ganzen Zeit bis zum Ende 1945. Dort war er in irgend einer Schreibstube, was nicht verwunderte bei seinem Beruf.
Am Samstag, dem 1. Februar 1941 war er jedenfalls zu Hause, obwohl Mutti immer gehofft hatte, ich wäre erst am 19. Februar, an ihrem eigenen vierzigsten Geburtstag zur Welt gekommen.
In der Nacht zum Sonntag, dem 2. Februar 1941, war es dann soweit. Meine Geburt kündigte sich mit aller Macht an. Noch am Nachmittag durfte Ursel, meine Schwester, auf Muttis Bauch fühlen, wie ich mich bewegte. Aber nachts waren nur noch Mutti und Vati allein im Schlafzimmer.
Um drei Uhr in der Frühe wurde Mutti sehr unruhig. Sie konnte nicht mehr schlafen. Plötzlich spürte sie einen kleinen Ruck im Unterleib, das Fruchtwasser ging ab. Vati stand auf und bestellte ein Taxi.
Auch das kam mir immer sehr eigentümlich vor, dass man mitten im Krieg ohne Probleme ein Taxi bestellen konnte.Alle Taschen waren gepackt, Mutti konnte allein die Treppen hinuntergehen, nachdem der Taxifahrer geschellt hatte. Vati trug die Taschen. Ursel schlief, Opa Fiori war zu Besuch da, er wurde geweckt, damit er auf Ursel aufpassen konnte. Das Krankenhaus, das uns aufnahm, hieß Huyssensstift, ein damals ziemlich neues und recht modernes Haus. Mit der Geburt ging es sehr schnell. Vati wurde sofort nach Hause geschickt, nachdem er seine Frau abgeliefert hatte, und fuhr mit dem gleichen Taxi wieder zurück. Damals war es noch nicht üblich, dass Väter im Kreißsaal zusehen und tröstend das Händchen der Angetrauten halten durften bei der Geburt. Meine Mutter lag schneller im Kreißsaal, als sie selbst es beschreiben konnte. Dort bekam sie dann ein Pfeifchen, wie sie erzählte. Bis zur Geburt meiner eigenen Kinder konnte ich mir darunter nichts vorstellen, hatte aber das unbestimmte Gefühl, dass es der Mutter irgendwie half, über die Schmerzen der Geburt hinwegzukommen oder das Pressen zu erleichtern.Danach war alles gekommen wie im Sturzflug. Mutti hatte kaum gespürt, dass die einsetzenden Presswehen sehr rasant dafür sorgten, dass zuerst das Köpfchen aus dem Geburtskanal herausschaute und schon mit einer weiteren Presswehe der Körper des Säuglings herausschoss. Eine stark entwickelte Akro-Phobie meinerseits könnte vielleicht mit diesem Geburtsvorgang erklärt werden.Im Familienstammbuch auf der Seite 7 liest sich der Vorgang so: Zweites Kind: Geburtsregister Nr. 202 des Jahres 1941 G Geburtsschein. Vornamen und Familienname: --------------------------------------------------------------- ------------------------Harald Walter Fiori---------------------------- geboren am 2 ten Februar-------------------------1941 in Essen------------------------------------------------------- ---------------------Essen am 5. Februar-----------1 941 Der Standesbeamte In Vertretung Das runde Siegel mit den runenähnlichen Worteinträgen Standesamt in Essen ziert mittig ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen, an dessen unterem Ende, also am Schwanz ein Kreis zu sehen ist mit einem Hakenkreuz in der Mitte des kleinen Kreises. Unleserliche Unterschrift
Es ergibt sich die Frage, ob das Hakenkreuz, wie ich es interpretiert habe, tatsächlich unten in die Schwanzspitze gehört. Aus heutiger Sicht der deutschen Geschichte hätte es dort am besten seinen Platz gehabt und wäre von der deutschen Bevölkerung nie beachtet worden.Wann immer ein religiöses Zeichen oder religiöse Rituale und Gepflogenheiten zum Missbrauch herangezogen werden, sollten die Menschen aufschreien und den Missbrauch ablehnen, damit Diktaturen, ganz gleich welcher Art, sich nicht über angeborene Menschenrechte hinwegsetzen können, mit den Symbolen , die von Menschen verehrt werden oder wurden.Darunter ist eingetragen, dass ich am 9. Februar 1941 in der St. Hubertus-Pfarre (Huyssensstift) zu Essen getauft wurde. Darunter ein Siegel der Pfarrkirche. „Wie viele Eindrücke stürmen auf ein Kind ein, wenn es gerade zur Welt gekommen ist. Nichts ist mehr so warm und mummelig wie vor der Geburt. Warum bin ich nur so allein? Was schreit da dauernd? Bin ich das etwa selbst? Es ist so grell! Nein da kommt etwas. Am besten mache ich mal meinen Mund ganz klein und meine Augen ganz groß! Ah, da werde ich mollig und warm angelegt! Wie herrlich! Ich spüre heimeliges Herzklopfen! Etwas spricht beruhigend mit mir. Diese Stimme klingt schön, beruhigend, lieb und anheimelnd. Warme Haut!“„Warum trinkt der Junge denn nicht, Schwester? Er muss doch trinken!“ fragte bang meine Mutter, während sie vergeblich versuchte, mich anzulegen. „Der hat die ganze Zeit geschrieen, jetzt ist er zu müde zum Trinken“, lautete die Antwort. „Aber ich habe doch so viel Milch, Schwester, was soll ich denn damit machen. Wohin nur mit der ganzen Milch?“ klagte Mutti. Das Abpumpen war nicht gerade sehr angenehm gewesen, aber Bübchen, wie ich fortan genannt wurde, wollte einfach nicht trinken. Traute, meine Tante Traute, Muttis beste Freundin, wurde um Rat gefragt, immerhin hatte sie bereits am 5. Dezember ein süßes kleines Mädchen zur Welt gebracht, viel süßer und hübscher als der hässliche Glatzkopf, der in Muttis Armen lag, mit seinem Stiernacken, wie Oma Fiori gesagt hatte, „Wie entsetzlich, ein Stiernacken! Hoffentlich behält Oma nicht recht, hoffentlich wächst sich das wieder aus. Männer mit Stiernacken sind etwas Unangenehmes, etwas Hässliches!“ Tante Trautes Ratschläge trösteten wenig: „Das gibt sich, wenn ihr erst einmal zu Hause seid. Vielleicht ist der Junge ja auch nicht ganz normal, du solltest zum Kinderarzt gehen, sobald du wieder zu Hause bist!“ Doch das war nicht die einzige Schwierigkeit, die durch den Säugling entstand. Der Bengel musste getauft werden. Eigentlich kein besonderes Problem, sollte man annehmen. Aber Mutti war katholisch und das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, war evangelisch, nämlich das Krankenhaus der evangelischen Huyssensstiftung Warum nur war die Taufe so eilig? Warum musste sie unbedingt noch in der Klinik erfolgen? War es wegen des Krieges? War es damals üblich? Mutti gab nie eine plausible Erklärung dafür ab. Es war einfach nur eine sehr schnelle und aufregende Taufe.Die Taufe soll vor allen Dingen Kinder davor bewahren, vielleicht nicht ins Himmelreich zu kommen, wenn sie denn schnell sterben würden. Wenn man als Christ erzogen und immer wieder belehrt wurde, mutet das sehr eigentümlich an, weil doch gerade Kinder in ihrer Unschuld überhaupt nicht von Gott verstoßen werden, sondern in allen Ländern der Welt, so lehrt es das Christentum, von Gott liebevoll als Kinder Gottes, des Allmächtigen, ohne Wenn und Aber, angenommen werden. So lehrt es die Bibel. Aber möglich ist es natürlich, dass das Kind noch von der Erbsünde belastet ist, was immer man darunter zu verstehen hat. Ich selbst fühlte mich weder sündig noch belastet, noch bekam ich überhaupt wissentlich etwas von der ganzen Taufe mit. Wäre es anders müsste ich folgendes erzählen:Mutti hatte mir anvertraut, dass am Sonntag Taufe sein sollte. Da kämen alle Taufpaten und Verwandten, die noch Zeit hätten und es wäre überhaupt alles sehr feierlich und wichtig. Opa wäre ganz stolz auf seinen ersten männlichen Enkel und wollte deshalb unbedingt Pate werden. Eigentlich wäre es uns ja lieber gewesen, Onkel Jupp wäre Patenonkel geworden, weil Onkel Jupp der Lieblingsbruder von Mutti sei, aber leider bekäme Onkel Jupp keinen Urlaub. Onkel Jupp wäre gerade im Feldlazarett, wo er als Arzt eingesetzt war. Aber ich müsste auch unbedingt eine Patentante haben. Dafür hatte sich Tante Dorchen bereitgefunden. Tante Dorchen war die Frau von Onkel Willi, dem jüngeren Bruder meiner Mutti. Vatis Verwandtschaft kam nicht in Frage, weil die alle evangelisch waren. Opa eigentlich auch, aber bei Opa war das eine Ausnahme. Mutti hatte auch gemeint, ich sollte mich mal richtig freuen auf den Ehrentag. Am Sonntag, dem 9. Februar 1941 war es dann so weit, genau sieben Tage nach meiner Geburt. Was machten die nur mit mir?! Nicht nur Windelpuck und alles Unbequeme wurde mir angezogen, nein nun musste es auch noch ein Taufkleidchen sein. War es vielleicht das, was meine Schwester schon vor sechs Jahren angehabt hatte? Alle waren da und es wurde viel erzählt, viel zu laut, störend. Mutti hatte sich auch fein gemacht, wurde aber in einem Stuhl geschoben, weil sie zu schwach war die ganze Strecke bis zur Taufkapelle zu laufen. Vati schob sie. Opa trug mich auf seinem Arm, und ich schlief mal vorsichtshalber ein. Der Weg durch die unterirdischen Gänge des Krankenhauses war recht unheimlich. Dann ging es ein Stück über die Straße, danach wieder in den Kellerzugang zum Elisabeth-Krankenhaus. Das Haus war katholisch und verfügte über eine eigene kleine Kapelle. Da ich schlief, bekam ich nicht mit, ob eine Orgel spielte oder ob nur gesungen wurde. Plötzlich wurde ich unsanft geweckt. „Na, was soll denn das? Was soll ich denn mit dem Wasser im Gesicht? Und das komische Gemurmel über meinem Kopf? Ba, nun schmiert der Kerl mir auch noch irgendeine Salbe ins Gesicht. Wie ekelhaft und unappetitlich!“ Opa und Tante Dorchen mussten auch etwas sagen. Ja, und dann war der Spuk auch schon vorbei. Man beglückwünschte Mutti und Vati herzlich, danach ging es durch alle Gänge wieder zurück in das Krankenhaus, in dem ich geboren worden war. Na endlich, die freundliche Schwester nahm mich in Empfang, zog mir die überflüssigen Sachen aus und legte mich in mein Bettchen. Irgend ein Kind schrie immer, sollte ich nun auch mal ein wenig schreien oder lieber schlafen. Na, ja erst mal etwas schreien, schließlich war ich doch unsanft aus meiner Gewohnheit gerissen worden. Dass ich als Zweitnamen den Vornamen Walter erhielt, war nicht wegen möglicher Bräuche, den Vornamen des eigenen Vaters an den Sohn zu vererben, sondern hatte den ganz einfachen Grund, dass es zur Zeit meiner Taufe keinen heiligen Harald gab. Als katholisch getauftes Kind musste ich aber als Taufnamen den Vornamen wenigstens eines Heiligen bekommen, um später dann diesen Namenstag feiern zu können. Ich hatte nie verstanden, warum ausgerechnet mein Vater mit dem Vornamen Walter ein Heiliger gewesen sein sollte. Vati war mit den ganzen Verwandten nach Hause gefahren, wo nett die Taufe gefeiert wurde. Mutti war in ihrem Zimmer im Krankenhaus geblieben und erschöpft sofort eingeschlafen. Sie hatte von der Taufe die geringste Freude gehabt. Nie wurde später auch davon Näheres erzählt. Mich hätte brennend interessiert, warum die Taufe unbedingt in so kleinem beengten Kreis in der kleinen beengten Kapelle im benachbarten Krankenhaus stattfinden musste. Aber darauf bekam ich nie eine Antwort. Sollte der Krieg und seine Auswirkungen eine Rolle gespielt haben, oder war es möglicherweise doch Geldmangel? Denn bei aller von Reichtum zeugenden Pracht der hochherrschaftlichen Möbel, war eigentlich immer eine besondere Art von Armut in unserer Familie sehr deutlich zu spüren, von der natürlich niemals offen geredet wurde. Schließlich hatte man ja einen Ruf zu verlieren. Und Armut war immer auch ein Zeichen von geringer Bildung und von geringer Herkunft, zumindest in den Augen unserer Familie.